Walburga Fröhlich, Expertin für Barrierefreiheit in der Information, erklärt im Interview, warum leichte Verständlichkeit von Texten immer wichtiger wird, was österreichische Behörden hier besser machen müssen und wie viele Menschen von einem Umdenken profitieren könnten.
Wir leben in einer Informations- und Kommunikationsgesellschaft. Das bedeutet: Es wirkt sich ganz grundlegend auf unsere Lebensqualität aus, ob wir gut verstehen können, was uns Medien, Behörden oder unsere Mitmenschen sagen und schreiben. Menschen mit geringer Lesekompetenz tun sich in der Regel schwer, am öffentlichen Leben teilzuhaben oder Zugang zu Informationen zu finden. Besser gesagt: Es wird ihnen schwer gemacht. Denn trotz allen digitalen Fortschritts sind einfach zu viele Texte von Behörden oder Unternehmen nicht verständlich genug geschrieben. Walburga Fröhlich will das ändern. Sie ist Co-Gründerin und Geschäftsführerin von capito, einem der bekanntesten deutschsprachigen Unternehmen im Bereich barrierefreier Information und leicht verständlicher Sprache. Das Grazer Unternehmen „übersetzt“ Texte so, dass sie von möglichst vielen Menschen verstanden werden.
Leichte Sprache und Einfache Sprache
nennt man standardisierte vereinfachte Schreibstile, die für Menschen mit geringen Lesekompetenzen verständlich sind. Der Oberbegriff für beide Formen heißt leicht verständliche Sprache.
Frau Fröhlich, wie groß ist die Bevölkerungsgruppe, die aufgrund ihrer niedrigen Lesekompetenz auf Texte in leicht verständlicher Sprache angewiesen wäre?
Walburga Fröhlich: Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) teilt Lesekompetenz in sechs Stufen ein – von 0 bis 5. In Österreich befinden sich rund 17 Prozent der Bevölkerung zwischen 16 und 65 Jahren in den untersten beiden Stufen. Sie bräuchten also Texte, die in Leichter Sprache verfasst sind. Weitere 37 Prozent liegen bei Kompetenzstufe 2. Auch das ist noch immer zu wenig, um zum Beispiel wirklich gut mit Behörden kommunizieren zu können. Diese Gruppe bräuchte Texte, die in Einfacher Sprache geschrieben sind.
Leichte Sprache
ist eine einfache Version der Standardsprache, die Informationen leichter verständlich macht. Sie wurde speziell für Menschen mit Behinderungen und Lernschwierigkeiten entwickelt. Leichte Sprache hat festgelegte Regeln, gibt aber auch Empfehlungen zur Textgestaltung. Es kommen fast ausschließlich kurze, allgemein bekannte und leicht zu lesende Wörter vor. Auch die Sätze sollten möglichst kurz bleiben.
Einfache Sprache
ist ebenfalls eine vereinfachte Version der Standardsprache, setzt aber etwas mehr Vokabel und auch Vorwissen voraus als Leichte Sprache. Die Sätze sind in der Regel relativ kurz und einfach aufgebaut. Fremdwörter, Fachbegriffe und Metaphern werden vermieden. Texte in Einfacher Sprache unterscheiden sich aber häufig nur gering von regulär veröffentlichten Texten auf Websites oder in Zeitungen. Ihr Ziel ist es, möglichst viele Menschen zu erreichen.
Wie lässt sich diese Gruppe demografisch beschreiben?
Fröhlich: Aus der sogenannten Level-One-Studie der Uni Hamburg, die für Deutschland gemacht wurde, wissen wir, dass es sich hier hauptsächlich um Menschen zwischen 45 und 65 Jahren handelt – darunter mehr Männer als Frauen. Und mehr als die Hälfte davon haben Deutsch als Erstsprache. Überdurchschnittlich viele Menschen dieser Bevölkerungsgruppe sind außerdem erwerbslos oder machen Hilfstätigkeiten. Auch viele Menschen mit kognitiven Behinderungen gehören dazu. Deren Anteil ist im Verhältnis zum riesigen Bedarf an leicht verständlicher Sprache in der Gesamtbevölkerung allerdings sehr gering.
„Niedrige Lesekompetenz“ bedeutet ja nicht, dass diese Menschen Analphabet:innen sind. Was also sind ihre Schwächen?
Fröhlich: Um einen Text zu verstehen, muss ein Mensch auch ein gewisses Vorwissen und Vorerfahrungen mitbringen. Man muss ja nicht nur die einzelnen Wörter eines Textes sprachlich erfassen können, sondern auch den Kontext verstehen, auf den ein Text verweist. Menschen mit Down-Syndrom besitzen beispielsweise ganz unterschiedliche Lesekompetenzen, je nachdem, ob sie ihr Leben eher in reglementierten Institutionen oder zum Beispiel in inklusiven Wohngemeinschaften mit mehr Selbstbestimmung verbringen. Letztere bringen viel mehr Vorwissen über den Ablauf gesellschaftlicher Normen mit, weshalb ihnen auch das Verstehen von Texten deutlich leichter fällt. Ähnlich ist es bei Migrant:innen. Sie bringen unterschiedliche kulturelle Hintergründe mit, und je nachdem erfassen sie die Inhalte deutscher Texte schneller oder langsamer. Das heißt, ein Finne, der nach Österreich zieht, wird hiesige behördliche Texte wahrscheinlich leichter verstehen als ein Afghane, auch wenn beide auf demselben Deutsch-Niveau sind. Daher ist es sinnvoll, bei der Übersetzung eines Textes in leicht verständliche Sprache mehrere Sprachstufen anzubieten – von ganz einfach bis weiter fortgeschritten.
Da wären wir erneut bei den Kompetenzstufen. Welches Schema verwenden Sie in Ihrer Arbeit und warum?
Fröhlich: Bei capito orientieren wir uns am bereits erwähnten Schema des Programme for the International Assessment of Adult Competencies (PIAAC) der OECD sowie am Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für Sprachen (GERS) mit den sechs Stufen von A1 bis C2. Die ersten drei GERS-Kategorien verwenden wir bei capito auch für die Abstufung der von uns produzierten Texte, weil sie viele Menschen vom Sprachenlernen bereits kennen. Man weiß sofort: A1 ist die einfachste Variante eines Textes, A2 ist etwas anspruchsvoller, und B1 ist noch ein Stück fortgeschrittener.
Woher stammt eigentlich die Idee für Leichte Sprache, und wie hat sie sich entwickelt?
Fröhlich: Das Konzept von Leichter Sprache kommt aus der People-First-Bewegung, einer Empowerment-Bewegung von Menschen mit kognitiven Behinderungen, die es seit den 1970er Jahren gibt. Diese Bewegung legt Wert darauf, Menschen mit Behinderung treffender als Menschen mit Lernschwierigkeiten zu bezeichnen. Und als wichtigen Hebel für das Lernen erklärte sie eine leicht verständliche Sprache zu einer ihrer Hauptforderungen. Ab den frühen 2000er Jahren hat sich Leichte Sprache im deutschen Sprachraum immer mehr verbreitet. Wobei es in Deutschland sicher stärkere Lobbyinggruppen gibt als in Österreich. Was Einfache Sprache betrifft, so denke ich, dass diese Entwicklung viel mit einem Wandel im Selbstverständnis der Behörden zu tun hat: weg vom Hoheitsanspruch, hin zum Servicegedanken. Man hat zunehmend erkannt, dass man mit allen Bürgerinnen und Bürgern so sprechen muss, dass sie einen wirklich verstehen.
Frau Fröhlich, wenn man alte Zeitungen liest, etwa aus den 1920er Jahren, so fällt auf, dass damals selbst Boulevardblätter oft sehr lange, sehr elaborierte Artikel brachten. Trotzdem waren es Massenmedien. Waren die Zeitungen damals weniger leserfreundlich als heute? Oder hatten die Menschen vor hundert Jahren eine höhere Lesekompetenz?
Fröhlich: Das ist eine interessante Beobachtung: Ja, der Schreibstil in Zeitungen war früher viel verschnörkelter – aber Verschnörkelung ist auch eine Form der Vereinfachung. Zeitungsartikel haben damals viel langsamer in ein Thema hineingeführt, haben viel mehr erläutert. Der Stil war erzählerisch und bildhaft. Heutige Zeitungsartikel sind sehr dicht und reihen noch dazu einen Fachbegriff an den anderen. Der Stil ist deutlich elaborierter und schwieriger zu verstehen.
Und was die Lesekompetenz vor hundert Jahren betrifft: Sie war insgesamt viel niedriger als heute. Wir wissen, dass rund 30 Prozent der Kinder in den 1920er Jahren nicht in die Schule gegangen sind – trotz Schulpflicht. Lesen war außerdem noch eine klare Männerdomäne, vor allem das Zeitunglesen.
Wie beurteilen Sie im Allgemeinen die österreichischen Behörden, was leicht verständliche Sprache betrifft?
Fröhlich: In jeder Hinsicht unterirdisch. Und zwar nicht nur in Bezug auf Leichte Sprache und Einfache Sprache, auch die „ganz normale“ Kommunikation mit den Bürger:innen, die Information auf Websites und dergleichen, ist weitgehend ein Armutszeugnis. Und es ist wirklich ärgerlich, wie nonchalant sich viele Behörden über dieses offenkundige Problem hinwegsetzen – wo es ja noch dazu gesetzliche Anforderungen gäbe. Nur einige wenige Stellen bemühen sich.
Haben Sie eine Erklärung dafür?
Fröhlich: Es ist wohl eine ungesunde Mischung aus behördlicher Trägheit, noch immer vorhandenem Hoheitsdenken und der Tatsache, dass es keine Konsequenzen gibt: Die Behörde wird ja weiter existieren, egal ob sie verständlich kommuniziert oder nicht.
Gibt es vielleicht doch auch positive Beispiele in Österreich, die sich andere Behörden zum Vorbild nehmen könnten?
Fröhlich: Das Sozialministerium macht schon viel richtig. Auch das Land Tirol als ein Beispiel für die Bundesländer bemüht sich sehr. Die Stadt Wien hat sich entschieden, alle Texte auf ihrer Website grundsätzlich in Einfacher Sprache zu verfassen. Gleichzeitig verzichtet sie aber auf Leichte Sprache als zusätzliche Alternative, was ich bedauerlich finde. Das bedeutet, die 17 Prozent der Bevölkerung, die mit Leichter Sprache erreicht werden könnten, bleiben wieder einmal auf der Strecke.
Was geht verloren, wenn man auf leicht verständliche Sprache verzichtet?
Fröhlich: Während der Pandemie ist es sehr klar geworden: Wenn seriöse Expert:innen nicht verständlich genug kommunizieren, dann hören ihnen mit der Zeit eben nicht mehr viele Menschen zu. Wenn man den gesellschaftlich „Abgehängten“ in der Art der Kommunikation ständig mitteilt „Es ist mir egal, ob ihr mich versteht oder nicht“, darf man sich nicht wundern, wenn diese sich populistischen Akteuren zuwenden. Es handelt sich mittlerweile also um ein demokratiepolitisches Problem. Außerdem darf man den volkswirtschaftlichen Schaden von schwer verständlicher Kommunikation nicht unterschätzen. Eine Schweizer Studie hat etwa berechnet, dass drei Prozent der jährlichen Gesundheitskosten entstehen, weil Menschen Informationen wie die Wirkungsweise eines Medikaments oder den Ablauf einer Therapie nicht verstanden haben. Wir steuern auf eine Wissensgesellschaft zu, schließen aber immer mehr Menschen aus dieser Gesellschaft aus. Das führt zu enormem Vertrauensverlust.
Wie sieht die Bereitschaft zu leicht verständlicher Sprache bei privaten Unternehmen aus?
Fröhlich: In der Regel wesentlich besser als bei Behörden. Wenn etwa eine Firma in der Produktion oder auch im Dienstleistungsbereich viele Menschen mit niedrigem Bildungshintergrund beschäftigt, ist es sofort einleuchtend, dass leicht verständliche Sprache in der internen Kommunikation das Um und Auf ist. Ein Arbeitsunfall kostet ein Unternehmen durchschnittlich 3.000 Euro. Transparenz und verständliche Kommunikation gehören außerdem zu den Hauptmotiven für Beschäftigte, bei einem Unternehmen zu bleiben. In einem zukunftsorientierten und globalisierten Geschäftsumfeld kann man immer weniger davon ausgehen, dass alle Mitarbeiter:innen fließend Deutsch sprechen. Man muss einfach auf ein anderes Sprachlevel gehen. Hier ist eine völlig andere Sprache gefragt, als sie von den Pressemenschen in der Kommunikation nach außen gepflogen wird. Sprache muss viel mehr als Werkzeug für Informationsvermittlung gedacht werden.
Bildquelle: capito
Sie fragen sich, warum Sie eine Ad-Strategie erstellen sollten? Die Antwort ist simpel: Ohne (Beitrags-) Bewerbung in sozialen Netzwerken gesehen zu werden, ist heutzutage schwierig.
Die Konkurrenz zwischen Unternehmen, die um Konsument:innen werben, ist groß. Der Pool an loyalen Kund:innen, die ohnehin mit den eigenen Postings erreicht werden, ist bald ausgeschöpft. Deshalb finden Sie hier einen Step-by-Step-Guide für das Erstellen einer Ad-Strategie.
1. KPIs
Am Anfang stehen die sogenannten Key Performance Indicators (KPIs), also Kennzahlen, die die Leistung ihrer Ad aufzeigen. Viele sehen die Follower:innen-Zahl als wichtigste Kennzahl. Allerdings sagt diese nichts darüber aus, wer die Beiträge sieht, welchen Eindruck sie hinterlassen oder, ob sie etwa zum Kauf, zum Klick oder zum Abo angeregt haben. Enorm wichtige Kennzahlen sind daher das Engagement (Interaktion), Link-Klicks oder die Beitrags-Reichweite. Aber auch die Conversion-Rate, also beispielsweise der Prozentsatz an Einkäufen in einem Webshop aufgrund einer Ad-Schaltung, ist oft ein essentieller KPI. Definieren Sie in diesem ersten Schritt Ihre wichtigsten KPIs anhand Ihrer Ziele.
2. Inhalte
Schauen Sie sich danach Ihre bisherigen Social Media-Postings an. Gibt es Beiträge zu Produkten oder Botschaften, die Ihnen besonders wichtig sind? Notieren Sie sich die wichtigsten. Nachdem Sie sich einen Überblick verschafft haben, konzentrieren Sie sich auf die Kund:innen-Interessen. Legen Sie den Fokus dabei auf Ihre definierten KPIs. Ein Indikator für Interesse ist zum Beispiel die Anzahl der Likes oder Herzen, die beim ersten Blick auf die Postings von jedem/jeder selbst ermittelt werden kann. Auch hier sollten Sie die am besten bewerteten Postings notieren. Füllen Sie außerdem inhaltliche Lücken, die Ihnen bei der Analyse Ihres Feeds bewusst werden, mit Postings auf. Jetzt haben Sie nicht nur Ihre Schwerpunkte ermittelt, sondern ein erstes Gerüst für mögliche (Beitrags-)Bewerbungen geschaffen.
3. Budget
Neben den KPIs und Inhalten wird jede Ad-Strategie durch ihr Budget definiert. Gibt es die finanziellen Mittel, um jeden Beitrag zu bewerben? Oder ist es wichtiger, das vorhandene Budget auf ganz spezielle Postings zu setzen? Gibt es für Kampagnen oder Feier- und Thementage ein Sonderbudget oder kommt alles aus einem zu Beginn festgelegten Geldtopf? Berechnen Sie im ersten Schritt, wie viele Postings Sie bewerben wollen. Danach legen Sie mit Hinblick auf die gewünschten KPIs das Budget für ein Posting fest. Es lässt sich nicht pauschalisieren, wie viel mit einem bestimmten Betrag erreicht werden kann. Ziehen Sie für einen Richtwert daher entweder bereits beworbene Postings heran oder starten Sie einen Testlauf mit einem überschaubaren Budget von beispielsweise 30€. Danach geht es ans Hochrechnen: Multiplizieren Sie die nun festgelegte Zahl mit der Anzahl der Postings, die Sie im Monat bewerben wollen. Ihr Grundbudget steht. Falls Sie mit einem vordefinierten Budget arbeiten, drehen Sie den Prozess um.
4. Zielgruppe
Machen Sie sich klar, wen sie mit Ihren Postings erreichen wollen. Erstellen Sie im ersten Schritt Personas. Geben Sie der Person einen Namen und definieren Sie Alter, Wohnort und Beruf. Überlegen Sie sich, welche Hobbies und Interessen diese Person haben könnte. Nachdem Sie zwischen drei und fünf Personas entwickelt haben, können Sie daraus eine Zielgruppe festlegen. Entscheiden Sie, ob es sich für Ihre unterschiedlichen Schwerpunkte lohnt, mehrere Zielgruppen zu entwickeln. Falls Sie über Ihren Social Media-Account beispielsweise auch neue Mitarbeiter:innen recruiten wollen, empfiehlt es sich, eine Zielgruppe mit berufsspezifischen Keywords anzulegen. Ihre Zielgruppe gibt Ihnen anhand der demografischen Daten schon erste Anhaltspunkte dafür, welche zeitlichen und örtlichen Einschränkungen Sie bei der Ad-Schaltung berücksichtigen müssen. Außerdem können Sie schließlich beim Schalten der Anzeige relevante Keywords von ihr ableiten.
5. Dark Ads
Natürlich kann jeder gepostete Beitrag beworben werden. Manchmal ist es jedoch besser, wenn beworbene Postings im regulären Feed nicht für alle Follower:innen sichtbar sind. Sogenannte „Dark Ads“ machen Sinn, wenn ihr Inhalt von den Schwerpunktthemen abweicht oder ein großes Budget für dieses spezifische Posting vorgesehen ist. Wenn Ihre regulären Postings etwa 100 Likes generieren, die beworbenen jedoch 1000 Likes, sind diese unnatürlichen Spitzen durch Dark Ads für Konsument:innen nicht sichtbar. Überlegen Sie sich mit Hinblick auf die Posting-Strategie, ob es für Sie sinnvoll ist, Dark Ads einzuplanen.
6. Like Ads
Die Zahl der Follower:innen wird am nachhaltigsten mit authentischen und relevanten Inhalten aufgebaut. Aber auch hier kann mit einer guten Ad-Strategie und durch Ads mit dem Ziel Seitenlikes zu generieren (Like Ads) ein Anstieg erzielt werden. Für einen kontinuierlichen Anstieg ohne Spitzen und Täler ist auch eine kontinuierliche Bewerbung notwendig. Das bezieht sich sowohl auf die regulären Beiträge als auch auf die auf das Ziel zugeschnittenen Like Ads. Wenn es dieses Ziel nicht gibt, wie beispielsweise bei Instagram, muss der Umweg über eine Link-Klick-Ad genommen werden, also eine Ad, die Traffic generiert. Like Ads sind wichtig, da sich durch eine größere Community auch die nicht-beworbene, also organische Reichweite der eigenen Beiträge steigert.
Ihre eigene Ad-Strategie
Nun haben Sie Ihre Ziele definiert und ermittelt, wen Sie mit welchen Inhalten erreichen wollen.
Jetzt geht es an das Erstellen der Postings sowie um die Bewerbung selbst. Wichtig ist, dass eine Ad-Strategie immer wieder nachjustiert werden muss. Sei es, weil Sie Ihre definierten Ziele erreicht haben, weil Ihr Budget doch zu knapp bemessen war, oder weil Ihre Zielgruppe zu unscharf ist. Dabei hilft Ihnen das Reporting, das auf sozialen Medien meist für jede Bewerbung erstellt wird. Kontrollieren Sie die erreichten KPIs und adaptieren Sie die Ad-Strategie gegebenenfalls, um künftig noch mehr potenzielle Kund:innen mit Ihren Ads zu erreichen.
Bildquelle: pexels.com
Wie Sie mit Fotos auf Instagram bessere Geschichten erzählen und welche visuellen Strategien für mehr Social-Media-Engagement sorgen, erfahren Sie in unserem Blogbeitrag.
Gute Geschichten können in Worte gefasst oder mit Bildern, Grafiken und Videos erzählt werden. Jene Erzähltechnik, die auf visuelle Inhalte setzt, ist unter der Bezeichnung Visual Storytelling bekannt. Mit Bildern ist eine andere Kommunikation möglich. In ihrem Zentrum stehen die Farbgestaltung, Bildkomposition, Optik, Video-Editing, Effekte, Kamerabewegungen und Grafiken. Traditionell setzen vor allem Medien wie Film und Fernsehen auf Visual Storytelling. Ein historisches Beispiel ist die Malerei. Die ersten Zeugnisse der Menschheitsgeschichte waren Bilder an Höhlenwänden, die von den Lebenswelten unserer Urahnen erzählen. Durch Fotografie, Technologien und Social Media vervielfältigen sich die Möglichkeiten Geschichten grafisch zu erzählen in den vergangenen Jahrzehnten jedoch enorm. Visueller Content wurde in der Onlinewelt immer wichtiger, bis 2010 mit Instagram die bislang einflussreichste Foto- und Video-Plattform entstand.
Welche Vorteile verspricht gutes Visual Storytelling auf Instagram?
Visual Storytelling auf Instagram schafft Aufmerksamkeit für Ihre Projekte und Anliegen. Diese Aufmerksamkeit wird benötigt, um den eigenen Content sichtbarer und damit wichtiger zu machen. Visual Content ist Texten überlegen, wenn es um den „passiven“ Konsum einer Botschaft geht. Laut Studien werden Bildbeiträge auf Social Media viel stärker wahrgenommen als Texte. Das gilt insbesondere für Fotos.
Zusammenfassend wird mit Visual Storytelling Content geschaffen, der
- Attraktiver ist und daher mehr Follower bringt.
- Mehr Engagement
- Uns länger in Erinnerung
Tipp
Lesen Sie hier, wo sie Visual Content neben Instagram noch platzieren können.
So machen Sie bessere Fotos
Heute verfügt jedes Smartphone über eine Kamera. Oft lassen sich Smartphone-Fotos nur mehr schwer von professionellen Kameraaufnahmen unterscheiden. Aber für erfolgreiches Visual Storytelling genügt es nicht, nur das Smartphone hinzuhalten und den Auslöser zu drücken. Ein paar Grundregeln zur Bildgestaltung können Ihnen dabei helfen, bessere Smartphone-Fotos zu machen:
Der Goldene Schnitt besagt, dass ein Bild in neun Quadranten unterteilt wird. Deshalb ist es hilfreich, die Rasterfunktion am Handy einzuschalten, um das richtige Verhältnis im Blick zu haben. Die wichtigsten Bildpunkte sowie der Horizont sollten an diesem Raster ausgerichtet werden. Sie dürfen aber auch experimentieren: Asymmetrie etwa kann Spannung zwischen mehreren Objekten erzeugen.
Das Spiel mit Vorder- und Hintergrund kann Fotos interessanter machen. Eine gedankliche Trennung dieser Ebenen hilft dem Betrachter, auf eine der beiden stärker zu fokussieren. Ein Objekt im Vordergrund kann einem Bild das gewisse Etwas verleihen.
Verschiedene Einstellungsgrößen haben unterschiedliche Wirkungen. Soll ein Detail eines großen Ganzen gezeigt werden, kann eine Nahaufnahme sinnvoll sein. Fotografieren Sie aber eine Straße mit Hochhäusern, dann sollten Sie eine wesentlich größere Einstellung wählen.
Auch die Perspektive entscheidet, wie der User das Foto wahrnimmt. Ein Foto kann aus unterschiedlichen Blickwinkeln oder Kamerahöhen aufgenommen werden. Eine von unten fotografierte Person wirkt größer und dominanter. Eine Frontalaufnahme erweckt einen anderen Eindruck als eine Seitenperspektive.
Berücksichtigen Sie Linien in der Bildkomposition. Um uns herum existieren viele direkte und indirekte Linien, die auf Fotos oft noch besser zu erkennen sind. Die Linien helfen dabei, den Blick des Users zu lenken.
Lichter beeinflussen ein Foto ähnlich wie Farben. Achten sie auf das natürliche Licht, das sich tageszeitenabhängig verändert. Auch mit künstlichem Licht können der Fotografie schöne Akzente gesetzt werden. Denken Sie an Lampen, Kerzen oder andere Beleuchtungsmittel.
Farben und Kontraste können die Bildgestaltung stark beeinflussen. Kontrastierende Farben verändern ein Foto. Farben unterscheiden sich nach Farbton, Helligkeit und Sättigung. Auch Trends spielen hier eine Rolle. Das Unternehmen Pantone kürt jedes Jahr eine einflussreiche „Farbe des Jahres“.
Ein guter Instagram-Feed sorgt für Aufmerksamkeit
Beim Visual Storytelling auf Instagram kommt es nicht nur auf das einzelne Bild an. Auch die Zusammenstellung der Bilder ist wichtig. Dabei sollten Sie sich zunächst überlegen, wer die Zielgruppe Ihres Feeds ist. Wen möchten Sie ansprechen? Wie fügt sich das einzelne Bild in den Feed insgesamt ein? Auch für Ihren Feed gibt es einige Gestaltungstipps:
Es gibt unterschiedliche Bild-Formate. So können Sie Ihrem Feed etwa durch bestimmte Rahmen das gewisse Extra verleihen. Auch eine Variation von Hochformaten und Querformaten kann den Feed optisch aufwerten.
Ein interessantes Stilmittel ist die Collage. Dabei fügen sich die einzelnen Postings zu einem großen Ganzen zusammen, wenn sie im Feed betrachtet werden. Ihrer Kreativität sind dabei kaum Grenzen gesetzt.
Auch im Gesamtkonzept können Farben einen wesentlichen Unterschied machen. Hier dürfen Sie mutig sein. Achten Sie jedoch darauf, dass die verwendeten Farben der einzelnen Posts zueinander passen.
Wie bereits beschrieben, können auch Farbkontraste einen Feed insgesamt hervorheben. Achten Sie aber bei der Verwendung von starken Kontrasten auf ein durchgängiges Konzept.
Bestimmte Motive können die Hauptrolle in einem Instagram-Feed spielen. Als Hauptmotiv kann etwa eine bestimmte Person oder spezielle Produkte dienen, die immer wieder gezeigt werden.
Manchmal ist es beim Visual Storytelling sinnvoll, auch Texte zu verwenden. Ein Beispiel sind Zitate, mit denen sie Ihren Bildcontent anreichern. Achten Sie aber auch hier auf ein durchgängiges Konzept, zum Beispiel bei der Wahl der Schriftart und Schriftfarbe.
Nützliche Tools
Nicht immer sind teure Grafikprogramme für die Bildbearbeitung notwendig. Fotobearbeitung wird durch Tools wie Canva oder Crello vereinfacht:
Welche Farben derzeit im Trend liegen, erfahren Sie bei Pantone.
Bildquelle: pexels.com
In Communities fühlen sich Menschen miteinander verbunden – in der echten wie in der virtuellen Welt. Unternehmen möchten dieses Gefühl von Verbundenheit bei ihren Kund:innen erzeugen. Dabei hilft Community Management.
In einer Gemeinschaft werden Inhalte, Informationen, Anliegen und Anregungen geteilt. Dies erzeugt Nähe und ein Gefühl der Zugehörigkeit. Besonders für Unternehmen ist es erstrebenswert, diese Emotionen bei ihren Kund:innen hervorzurufen.
Doch wie stellt man in der digitalen Welt das Gefühl menschlicher Nähe her? Hier kommt Community Management ins Spiel. Es hilft Unternehmen dabei, sogenannte „Markengemeinschaften“ auf ihren eigenen Social-Media-Kanälen zu kreieren. Diese bestehen aus treuen Kund:innen, die die propagierten Werte des Unternehmens teilen.
Sich näher kommen durch Community Management
Das Gefühl von Zugehörigkeit entsteht vor allem durch Zuwendung. Und das ist auch im Community Management eine der zentralen Möglichkeiten, Kund:innen emotional an Ihr Unternehmen zu binden. Daher ist es Aufgabe der Community Manager:innen, sich für die auf den Social-Media-Accounts gestellten Fragen sowie die Bedürfnisse und Anliegen der Kund:innen zu interessieren und sie zu beantworten. Durch die Interaktion fühlen sich Kund:innen wertgeschätzt und persönlich abgeholt, was wiederum deren Loyalität steigert. Community Management hilft Unternehmen außerdem dabei, ihre Marke menschlicher zu gestalten. Der regelmäßige und authentische Kund:innenkontakt, der in den Social Media Communities entsteht, macht ein Unternehmen nahbar und zugänglich. Kund:innen schenken ihm in Folge mehr Vertrauen.
An den Aktivitäten in den Social Media Communities können Unternehmen außerdem ablesen, wie ihre Produkte und Dienstleistungen bei den Kund:innen ankommen. Sie erhalten Zugang zu unverfälschtem Feedback und damit auch kritischen Stimmen. Diese können sie dazu nutzen, ihre Angebote zu optimieren und Marketing- und Contentstrategien entsprechend anzupassen.
Tipps für erfolgreiches Community Management
Community Management zielt darauf ab, eine enge Beziehung zwischen Unternehmen und Kund:innen herzustellen, die für beide von Vorteil ist. Folgende Tipps tragen zum Aufbau und Management einer funktionierenden Social Media Community bei:
- Den richtigen Ton anschlagen: In der Kommunikation auf sozialen Medien ist es stets wichtig, den richtigen Ton zu wählen. Dieser muss die Unternehmenskultur und -werte widerspiegeln und zum Content passen. In der Interaktion und Kommunikation mit den Community-Mitgliedern ist es vor allem wichtig, stets persönlich und freundlich zu agieren. Unpersönliche Antworten erzeugen Distanz zu den Kund:innen, die infolgedessen das Interesse verlieren.
- In (Inter-)Aktion treten: Durch reines Nachrichten beantworten, „Liken“ oder ein lapidares „Schön, dass Sie da sind“ binden Sie noch keine Kund:innen an sich. Richtiges Community Management animiert Menschen dazu, mitzumachen und aktiv zu werden. Auf sozialen Medien findet Diskurs statt, und dies sollte sich im Community Management abbilden. Dazu sollten Elemente, die zu Handlungen aufrufen, in den Social-Media-Content eingebaut werden. Beispiele hierfür sind:
-
- In den Captions, Grafiken, Stories oder Videos gezielt Fragen stellen,
- Umfragen an potenzielle Kund:innen ausschicken,
- Call-To-Actions in die Captions, Stories oder Grafiken integrieren, die den Nutzer:innen die Möglichkeit bieten, sich aktiv einzubringen.
- Kritik konstruktiv aufnehmen: Soziale Medien sind nicht nur ein Ort der Gemeinschaft, sondern auch der Meinungsverschiedenheit und Auseinandersetzung. Dass diese in Shitstorms oder Hetzkampagnen ausarten, ist keine Seltenheit. In solchen Fällen sind Community Manager:innen selbstverständlich dazu angehalten, die problematischen Kommentare zu löschen oder zu verbergen. Im Normalfall allerdings, wenn es sich lediglich um kritische Kommentare handelt, sollte man sie so wie sie sind stehen lassen. Ein Verbergen oder gar Löschen würde den oder die Nutzer:in unter Umständen sogar zu einem weiteren Angriff anregen. Außerdem ist Kritik auf sozialen Medien für Unternehmen durchaus hilfreich, da so gewisse Probleme oder bislang unberücksichtigte Fragen behandelt werden können. Dieser Erkenntnisgewinn kann dazu beitragen, die eigenen Produkte, Dienstleistungen oder Marketing- und Contentstrategien weiterzuentwickeln. Es ist daher im Community Management stets unabdingbar, proaktiv auf Kritik zu reagieren und diese ernst zu nehmen.
Beziehungspflege
Communities auf sozialen Medien sind Beziehungskonstrukte. Wie im echten Leben wollen sie kontinuierlich gepflegt werden, indem man zuhört, was die anderen zu erzählen haben, sich für deren Anliegen interessiert und sie unterstützt. Die meisten Menschen fühlen sich in einer Community wohl, da wir die Gesellschaft brauchen. Als Unternehmen sollte man das beherzigen und für seine Kund:innen einen solchen Raum schaffen – und dies gelingt durch richtiges Community Management.
Bildquelle: unsplash.com
Niemand vertritt ein Unternehmen besser als die Mitarbeiter:innen. In ihren Botschaften steckt enormes Potenzial – wenn man die Strategie richtig angeht. Im Interview mit Corporate-Influencer-Experte Klaus Eck erfahren Sie warum heutzutage relevante und wirksame Inhalte für jedes Unternehmen und deren Mitarbeiter:innen in den sozialen Medien wichtig sind und erhalten hilfreiche Tipps für die strategische Begleitung von Corporate-Influencer-Programmen.
Stellen Sie sich vor, Ihre Mitarbeiter:innen berichten auf Social Media regelmäßig positiv über das Unternehmen. Diese Vorstellung ist zu schön, um wahr zu sein? Im Gegenteil: Dieses erfreuliche Szenario kann anhand von Corporate Influencer:innen durchaus zur Realität werden. Doch was sind eigentlich Corporate Influencer:innen, Markenbotschafter:innen, Brand Ambassadors, Corporate Evangelist:innen, Unternehmensbotschafter:innens, Voices, Held:innen, Jobbotschafter:innen, Business Influencer:innen, Sinnfluencer:innen, Social Seller:innen, Testimonials, Themenbotschafter:innen oder Brand Advocates? In Unternehmen werden Corporate Influencer:innen unterschiedlich bezeichnet, wobei eine Abgrenzung nicht immer einfach ist. Durch die Digitalisierung und andere gesellschaftliche Entwicklungen verändern sich Unternehmensstrukturen radikal. Neue Kommunikationswege werden dadurch unabdingbar. Seit über 25 Jahren begleitet Klaus Eck Marken bei der Digitalisierung ihrer Unternehmens-, Marketing- und Kommunikationsprozesse. Als Gründer einiger Agenturen, Social-Media-Pionier, Keynote Speaker sowie Content-Marketing-Profi, weiß er ganz genau wie Unternehmenskommunikation funktioniert. Im Interview teilt er seine Erfahrungen in diesem Bereich und geht auf die wichtige Frage in jeder Content sowie Social Media Strategie ein: Welche Rolle haben die Mitarbeiter:innen in der Unternehmenskommunikation nach innen und außen?

Wie würden Sie das Konzept von Corporate Influencer:innen in einfacher Sprache erklären?
Klaus Eck: Vorstände, Geschäftsführer:innen, Marketers, Social-Media-Verantwortliche, Service- und Vertriebsmitarbeiter:innen, Personalverantwortliche oder Kommunikator:innen prägen das öffentliche Bild eines Unternehmens. Sie sorgen häufig für den ersten Eindruck, den ein Unternehmen vermittelt. In gewisser Weise sind Corporate Influencer:innen sogar Augen, Ohren und Stimme einer Organisation. Sie sind Mitarbeiter:innen, die bewusst von Unternehmen ausgewählt wurden und in der Mitarbeiter:innenkommunikation nach außen sowie nach innen vom Unternehmen sehr stark unterstützt werden. Als Repräsentant:innen haben sie im Idealfall einen guten Zugang zum Unternehmenswissen und können somit auf Kund:innenbedürfnisse sehr gut eingehen und auf diese Weise Kundenbindung vertiefen.
Welche Plattformen eignen sich besonders gut für Corporate Influencer:innen?
Klaus Eck: Es gab lange Zeit tatsächlich keine richtigen Plattformen dafür. Seit circa fünf Jahren hat sich LinkedIn als stabile Plattform entwickelt, die beruflich nutzbar ist. LinkedIn, aber auch alle anderen sozialen Medien vermischen mündliche und schriftliche Kommunikation. Letztendlich müssen die Tätigkeiten von Mitarbeiter:innen im Unternehmen in eine fachliche und persönliche Kommunikation übersetzt werden, um erfolgreicher die eigenen Botschaften nach innen sowie nach außen zu übermitteln. Menschen vertrauen Menschen, die ihnen nahe sind, die sie verstehen und denen sie eine gewisse Kompetenz zugestehen. Auf Postings „echter“ Menschen, die fachlich kommunizieren und dabei persönlich wirken, reagieren viele sehr positiv.
Wie wird man Corporate Influencer:in?
Klaus Eck: Das Unternehmen wählt bewusst Corporate Influencer:innen aus. Nicht jede:r Mitarbeitende eignet sich für diese Rolle und will in der digitalen Öffentlichkeit stehen. Das sollten Unternehmen akzeptieren und auf das Prinzip Freiwilligkeit setzen. Bei der Auswahl sollten Unternehmen darauf achten, dass es eine gewisse Affinität zum Thema Social Media gibt. Daraus sollte ein Unternehmen nicht falsche Schlüsse ziehen und nur junge Mitarbeiter:innen dafür wählen. Viel wichtiger ist die Branchenerfahrung, die sie als glaubwürdige Ansprechpartner: innen positioniert.
Welche Methoden gibt es, um an spannenden Content und wirkungsvolle Postings zu gelangen?
Klaus Eck: Ich frage jeden Interessierten, egal welchen Alters: „Welche drei Hashtags, beschreiben deine Aufgaben am besten?“. Dabei geht es darum, die drei wichtigsten Themen herauszukristallisieren, für die die Person brennt. Themenschwerpunkte erschließen sich dadurch sehr schnell. Meistens besteht die Schwierigkeit eher darin, sich auf drei Hashtags zu begrenzen. Diese drei Begriffe bezeichne ich als die digitale Identität. Anhand dieser Begriffe sollte sich jede:r überlegen, wie er oder sie auf andere wirkt beziehungsweise wirken möchte. Hierbei sollte immer berücksichtigt werden: „Wie kommen meine Botschaften an?“. Jeder kann für sich Schritt für Schritt eine kleine Content Strategie anlegen und somit auch bewusster kommunizieren. Dadurch wird ein Rahmen geschaffen und ein gezielter Fokus definiert.
Welche Ziele haben die meisten bei einer Corporate Influencer:innen Strategie?
Klaus Eck: Unternehmen verfolgen über ihre Corporate Influencer:innen unterschiedliche Ziele. Meistens ist der erste Wunsch dabei, dass Mitarbeiter:innen viel mehr über das eigene Unternehmen posten und veröffentlichen. Dabei geht es vor allem darum, die Sichtbarkeit für die wichtigen Themen im Unternehmen zu erhöhen und von der Expertise und Persönlichkeit ihrer Mitarbeiter:innen zu profitieren. Aktuell entscheiden sich Unternehmen für ein Corporate Influencer:innen Programm meistens aus drei Gründen:
- Um das Recruiting zu unterstützen und Mitarbeiter:innen zu finden.
- Um die Reputation zu verbessern und die Unternehmensbekanntheit zu steigern.
- Um mit gutem Storytelling und Content Creation die Kundenbindung zu stärken.
Warum sollten Unternehmen Ihrer Meinung nach auf Corporate Influencer:innen setzen? Was sind dabei die größten Vorteile?
Klaus Eck: Ein Corporate Influencer:innen Programm kann die digitale Transformation vorantreiben und die Kultur des Unternehmen verbessern. Viele Unternehmen unterschätzen, wie viel Corporate Influencer:innen in dieser Hinsicht leisten. Gute Corporate Influencer:innen Programme leben davon, dass sie die interne und externe Kommunikation stärken. Wichtig ist hier zu betonten, dass es um Personal Branding und nicht um Selbstdarstellung geht. Da diese Frage häufig gestellt wird, habe ich bereits eine Podcastfolge dazu aufgezeichnet.
Welche Schritte müssen vorab aus organisatorischer Sicht berücksichtig werden?
Klaus Eck: Organisatorisch sind vor allem zeitliche Ressourcen sehr wichtig. Jeder muss sich dessen bewusst sein, dass eine Strategie und ein Programm aufgestellt werden muss, um die Mitarbeiter:innen gut miteinzubinden. Im Vergleich zum generischen Begriff „Corporate Influencer“ werden Bezeichnungen sehr unterschiedlich genutzt. Das Spektrum reicht von Markenbotschafter:innen bis hin zu Held:innen und muss vom Unternehmen und dem dafür zuständigen Team definiert werden. In den frühen Phasen einer Community hängt sehr viel von den einzelnen Personen ab, die wichtigen Einfluss darauf haben, ob die Community gedeiht oder die Aktivitäten bereits nach einem kurzen Feuer wieder einschlafen. Interne Schulungen sowie regelmäßige Treffen sind hierbei sehr wichtig. Es muss eine Community gebildet werden, die auch Erfolge feiert und Ansprechpersonen zur Verfügung hat, mit denen sie sich austauschen kann. Ein Kernteam kümmert sich dabei in der Regel fünf bis zehn Stunden pro Woche, um den administrativen Teil, das Community Building sowie die interne und externe Kommunikation dieses Programmes.
Wie sollte beim Start eines Corporate Influencer-Programms die Devise lauten?
Klaus Eck: Ich sage gerne allen Beteiligten: „Vertraut einander!“. Ihr wollte gemeinsam eine bessere Welt schaffen und eure Ziele erreichen. Das schafft ihr am besten miteinander und nicht gegeneinander. Eine wertschätzende Kommunikation ist essenziell.
Buchtipp
„Die neue Macht der Corporate Influencer: Wie Mitarbeiter:innen die Kommunikation von Unternehmen verändern“- von Klaus Eck und Winfried Ebner
Bildquelle: Raimund Verspohl/klauseck.de | unsplash.com
Social Media-Kanäle beeinflussen die Kaufentscheidungen ihrer Userinnen und User. Mit „Shoppable Content“ können Sie Ihrem Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil auf den Plattformen verschaffen.
Die Digitalisierung, Social Media und E-Commerce sind Themen, die immer wieder im gesellschaftlichen Kontext auftauchen – und das nicht erst seit dem Beginn der Corona-Pandemie. Im Laufe der letzten Jahre rückten sie jedoch immer näher zusammen, um Unternehmens-Marketing erfolgreicher zu machen und den Umsatz zu steigern. Das neue Schlagwort, das Marketeers spätestens im Jahr 2022 kennen sollten, heißt „Shoppable Content“. Darunter sind alle Inhalte wie etwa Bilder, Videos, Postings oder Werbeanzeigen zu verstehen, die Userinnen und Usern ermöglichen, mit nur einem Klick direkt einen Kauf zu tätigen. So verkürzt sich der Weg potenzieller Kundinnen und Kunden zum Kauf auf ein Minimum und der Abschluss eines Handels wird wahrscheinlicher. Aber was genau ist nun „Shoppable Content“ und wie können Sie ihn für Ihr Unternehmen nutzen?
Was ist „Shoppable Content“?
Übersetzt man den Begriff „Shoppable Content“ auf Deutsch, wir sein Nutzen schnell klar. „Einkaufbarer Inhalt“ bezieht sich auf jede Art von Social Media Postings, Beiträgen auf Websites oder jeden anderen Inhalt, der Kundinnen und Kunden eine direkte Möglichkeit zum Kauf des abgebildeten oder beschriebenen Produkts bietet. Diese Marketing-Strategie ist für alle Unternehmen geeignet, die ihre Umsätze mithilfe unterschiedlicher Internet-Plattformen steigern wollen. In nur wenigen Schritten und ohne Unsummen an Budget wird mit „Shoppable Content“ ein deutlicher Mehrwert für potenzielle Kundinnen und Kunden geschaffen. Besonders wirkungsvoll ist das natürlich dann, wenn hinter dem Unternehmen eine starke Community steht. Deshalb sollte „Shoppable Content“ dort angeboten werden, wo am meisten Traffic stattfindet.
Generell gilt für die Customer Journey: Je weniger Schritte eine Nutzerin oder ein Nutzer benötigt, um von jenem Produkt, das ihr oder sein Interesse geweckt hat, zum Check Out des Warenkorbes zu gelangen, desto höher ist die Conversion. Außerdem wird durch die einfache Handhabung des „Shoppable Content“ auch die Customer Experience verbessert. Um diese Effekte zu erzielen, gibt es verschiedene Arten von „Shoppable Content“. Hier sind drei Beispiele:
- Shoppable Social Posts:
Besonders häufig kommt „Shoppable Content“ auf Social Media-Kanälen, allen voran auf den bildlastigen Plattformen Instagram und Pinterest, vor. Auf Instagram wird er beispielsweise durch eine kleine Einkaufstasche in einer der Bildecken markiert. Beim Öffnen wirkt das Posting wie jedes andere. Es enthält ein Foto samt Caption und Hashtags. Klicken Nutzerinnen und Nutzer jedoch auf das Foto, beziehungsweise auf das darauf abgebildete Produkt, gelangen sie erst auf eine Übersichtseite und von dort weiter zum gewünschten Produkt auf der Website der Anbieterin oder des Anbieters, oder können das Produkt gleich direkt in den Warenkorb legen. Ähnlich funktioniert das auch bei Video-Posts und Werbeanzeigen auf Social Media.
- Shoppable Text:
Auch in Blog-Artikeln oder Online-Magazinen finden sich „Einkaufbare Inhalte“ etwa via Verlinkungen, Call-To-Action-Buttons oder interaktiven Schaltflächen. So wird ein fließender Übergang zwischen Text und Bild sowie dem Produkt im Online-Shop der Anbieterin oder des Anbieters geschaffen.
- Shoppable Bilder:
Userinnen und Usern fällt es oft schwer, sich Produkte oder Kleidung an ihrem angedachten Platz oder angezogen vorzustellen. Visualisierungen rufen daher stärkere Emotionen bei potenziellen Kundinnen und Kunden hervor. Ein Möbelhaus ist beispielsweise gut beraten, ein optisch ansprechendes Foto eines möblierten Raums auf ihrer Website zu platzieren, in dem Userinnen und User auf einzelne Objekte klicken können und sogleich zum gewählten Produkt im Online-Shop weitergeleitet werden.
Beispiel: „Shoppable Content“ auf Instagram
Instagram Shops sind Online-Verkaufsflächen, in denen Produkte verkauft, markiert oder beworben werden können. Laut Instagram sind beinahe drei Viertel der Instagrammerinnen und Instagrammer der Meinung, dass die Plattform ihr Kaufverhalten beeinflusst. Zudem nutzen monatlich 130 Millionen Menschen „tap-on“ Shopping-Posts. Ein kostenloser Instagram-Shop kann also auch Ihrem Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil verschaffen. Für die Einrichtung braucht es nur wenige Schritte:
- Um Instagram Shopping verwenden zu können, benötigen Unternehmen eine Website-Domain und einen Online-Shop, auf dem jene Produkte zum Verkauf stehen, die auch über Instagram beworben werden sollen.
- Außerdem darf natürlich ein Instagram Business- oder Creator-Konto nicht fehlen.
- Verbinden Sie Ihren Instagram-Account mit Ihrem Facebook-Konto und richten Sie ein Business Manager-Konto ein.
- Die Einrichtung Ihres Shops erfolgt danach im Commerce Manager, in einer unterstützen Plattform wie Shopify oder WooCommerce oder direkt in der App.
- Ist Ihr Commerce-Manager eingerichtet und bereit loszulegen, wählen Sie die Checkout-Methode – also die Art, wie Ihre Kundinnen und Kunden den Shop verlassen sollen. Sie können entweder zu Ihrem Online-Shop verlinken, oder Kundinnen und Kunden das Produkt direkt in den Warenkorb legen lassen. Zweiteres bietet sich allerdings nicht an, wenn es beispielsweise mehrere unterschiedliche Farben des Produkts gibt, wenn es eher hochpreisig ist oder das Produkt Erklärungsbedarf hat.
- Sie können Ihren Shop entweder über Instagram, über Facebook oder über beide Plattformen ausspielen. Wählen Sie daher, in welchem Kanal Sie Ihren Shop einrichten wollen.
- Abschließend können Sie Ihren bestehenden Produktkatalog mit dem Shop verbinden oder neue Produkte anlegen. Ist das erledigt, leiten Sie Ihren Shop zur Prüfung durch Instagram weiter.
Sobald die Plattform ihr OK zu Ihrem neuen Shop gibt, können Sie anfangen, Ihre Produkte auf Instagram zum Verkauf anzubieten. Stellen Sie dabei sicher, dass Sie mit Einzel- und Karussell-Posts Abwechslung schaffen. Die Shoppable-Tags sollten so positioniert werden, dass klar ist, welches Produkt damit gemeint ist. Sie können zudem per Drag-and-Drop im Bild verschoben werden, sodass sie nicht zu viel verdecken. Mit Instagram Insights verfolgen Sie, wie Userinnen und User auf Ihre Postings und Produkte reagieren und wie hoch Engagement und Klickdaten sind. Aber merken Sie sich: Wie auch sonst stellen Authentizität und Menschlichkeit auf Instagram und anderen Social Media Kanälen heutzutage wichtige Erfolgsfaktoren dar. Das gilt auch für Ihren „Shoppable Content“.
Bildquelle: pixabay.com
Bildbeschreibungen unter Instagram-Postings – sogenannte Captions – werden zunehmen wichtiger. Sie informieren, unterhalten und erhöhen damit die Aufmerksamkeit für Ihr Unternehmen. Wir zeigen Ihnen, wie Sie Ihre Fotos in Zukunft ganz einfach mit Captions aufwerten können.
Sehen und gesehen werden – das ist es, was die Video- und Foto-Sharing Plattform Instagram ausmacht. Ob ein Posting dabei Erfolg hat oder nicht, hängt jedoch nicht allein von der Zahl der Followerinnen und Follower oder der Qualität der hochgeladenen Fotos ab. Die sogenannten Instagram Captions, beschreibende Texte unter den Bildern und Videos, tragen dazu bei, etwa die Verweildauer von Userinnen und Usern bei einem Post zu verlängern. Auch wird ein höheres Engagement Ihrer Community – also die Vergabe von Likes oder Kommentaren – hervorgerufen. Wir erklären Ihnen, warum Instagram Captions so wichtig sind und wie Sie die idealen Worte dafür finden.
Warum sind Bildbeschreibungen wichtig?
Es heißt zwar, „Bilder sagen mehr als tausend Worte“, aber im Falle von Instagram sind beschreibende Texte als Kontext sehr wertvoll. Das Soziale Netzwerk ist voll von herausragendem Visual Content, deshalb reicht es nicht, einfach nur hübsche Bilder zu posten. Captions sind relevant für den Aufbau einer Marke, die Vermittlung von Werten und die Kommunikation mit der Community. Zudem erkennt der Algorithmus der Plattform das Engagement der Userinnen und User. Reagieren also mehr Menschen auf ein Posting, indem sie es liken, teilen oder kommentieren, wird der Beitrag von Instagram als wichtiger gewertet und weiterempfohlen. So besteht die Chance, dass Userinnen und User, die Sie und Ihre Marke oder Ihren Instagram-Account noch nicht kannten, ebenfalls Teil Ihrer Followerschaft und in weiterer Folge auch Teil Ihrer Kundschaft werden. Allerdings sollte die Caption nicht primär nach Likes haschen, sondern einen Mehrwert für Ihre Leserinnen und Leser bieten – also informieren, unterhalten oder ungewöhnliche Einblicke ins Unternehmen geben. Kurz zusammengefasst beeinflussen Captions also:
- die Qualität und Persönlichkeit des Beitrags: Der Mehraufwand des Schreibens einer Caption fällt Userinnen und Usern positiv auf. Außerdem sticht Ihr Beitrag so aus der Masse hervor. Unternehmen können ihre Marke aufbauen, ihre Werte nach außen kommunizieren sowie wichtige Informationen mit der Community teilen.
- das Engagement der Community: Gute Captions fordern Followerinnen und Follower auf – beziehungsweise verleiten dazu – den geposteten Beitrag zu liken, zu teilen oder zu kommentieren. Das freut nicht nur die Schreiberinnen und Schreiber des Postings, sondern auch den Instagram-Algorithmus.
- die Verweildauer beim Posting: Interessante Bildbeschreibungen fesseln Userinnen und User länger als ein Foto allein. Auch die Zeit, die Userinnen und Userinnen bei Ihrem Posting verbingen, fließt positiv in die Bewertung durch den Algorithmus ein.
- die Reichweite der Beiträge: In weiterer Folge verhelfen sowohl ein hohes Engagement wie auch eine lange Verweildauer dazu, dass ein Posting vom Instagram-Algorithmus als besonders relevant bewertet wird. Er wird daher anderen Userinnen und Usern, die dem Account noch nicht folgen, auf der „Entdecken“-Seite So vergrößert sich nicht nur die Community, auch die Reichweite einzelner Beiträge wird erhöht.
Wie schreibt man eine gute Caption?
Theoretisch passt unter jedes Foto- oder Video-Posting eine Caption in der Länge von 2.200 Zeichen, zusätzlich maximal 30 Hashtags. Wenngleich es nur selten Sinn macht, den gesamten Platz zu nutzen, denn lange Captions sind nicht automatisch besser. Sofern es bei Ihrem Posting nicht um eine sehr spezielle Story hinter dem Bild geht, ist es besser, Sie bringen die Aussagen in Ihrer Bildunterschrift möglichst auf den Punkt. Immerhin lesen die meisten Userinnen und User nur den Beginn der Caption, bevor sie weiterscrollen. Wichtig ist:
- Information: Stellen Sie wichtige Informationen an den Anfang des Textes. So ködern Sie nicht nur Userinnen und User, sondern können auch sichergehen, dass der wichtigste Teil Ihrer Caption auf jeden Fall gelesen wird. Wenn Sie viel zu einem bestimmten Thema zu sagen haben, können Sie die Informationen auch auf zwei Postings aufteilen.
- Sprache: Ob blumig, förmlich oder jugendlich – die Sprache der Captions soll sich an Ihre Zielgruppe richten. Gleiches gilt für die Du- und Sie-Form, die Sie anpassen können. Grundsätzlich sollte die Bildunterschrift einfach zu lesen sein und ihre Tonalität konstant bleiben. Wichtig ist außerdem, keine Rechtschreib- oder Grammatik-Fehler im Text zu übersehen.
- Kreativität: Zitate berühmter Persönlichkeiten werden häufig in Texte eingebaut, sollten aber nicht im Überfluss verwendet werden. Ebenso wie trendende Text-Vorschläge oder typische Verkaufs-Floskeln aus dem Internet, da diese zu wenig individuell sind. Sinnvoller ist es, in den Captions menschlich zu bleiben und eigene Text-Ideen umzusetzen. Das erhöht auch Ihre Glaubwürdigkeit.
- Hashtags und Emojis: Hashtags sind wichtig, um von Userinnen und Usern mit ähnlichen Interessen gefunden zu werden. Es müssen nicht unbedingt 30 Stück sein! Im Gegensatz zum Text macht es hier durchaus Sinn, trendende Hashtag-Vorschläge zu übernehmen. Sie sind ein Indikator dafür, welche Themen gerade sehr beliebt bei der Community sind und häufig gesucht werden. So erreichen Sie mit Ihrem Posting ein größeres Publikum. Platzieren Sie Hashtags am Anfang oder am Ende eines Textes, um den Lesefluss nicht zu stören. Die Lesbarkeit eines Textes unterstützen auch gut platzierte Emojis. Selbst seriöse Seiten nutzen diese mittlerweile beispielsweise als Aufzählungszeichen, um Inhalte aufzulockern. Zu viele der kleinen Piktogramme wirken allerdings kontraproduktiv. Als Alternative können auch Absätze Textwüsten unterbrechen und lesbarer machen.
- Call-to-Action: Sogenannte Call-to-Actions (CTA), die Userinnen und User auffordern, die Unternehmens-Website über den Link in der Bio (Steckbrief unter dem Profilbild) zu besuchen, das Posting zu kommentieren oder Freunde zu markieren, erhöhen das Engagement. Auch Verlinkungen zu anderen Seiten können diesen Effekt haben und die verlinkte Person zum Teilen Ihrer Inhalte bewegen. So erhalten Sie nicht nur einen zusätzlichen Glaubwürdigkeits-Stempel, sondern auch kostenlose Werbung für Ihr Unternehmen.
Ob Storytelling-Captions, Kochanleitungen oder informative Texte – grundsätzlich können Sie sich bei Ihren Instagram-Bildbeschreibungen kreativ austoben. Es gibt kein Richtig oder Falsch – ob Ihre Caption am Ende bei Ihrer Community ankommt, erkennen Sie am Engagement der Userinnen und User. Wichtig ist jedoch, sich ausreichend Zeit für das Verfassen der Captions zu nehmen – denn nur so bringen diese Ihrem Unternehmen den gewünschten Erfolg.
Bildquelle: pixabay.com
Daniel Cronin ist bei Vielen unter dem Titel „der Pitch Professor“ bekannt. Im Interview verrät er, wie wichtig relevante und wirksame Inhalte sind, wie er mit der Angst vor Publikum zu sprechen umgeht und warum ein Pitch große Parallelen zu einem Date hat.
Daniel Cronin ist Entrepreneur, Moderator, Keynote-Speaker, Universitätslektor sowie einer der gefragtesten Experten und Trainer zum Thema Pitching in Europa. Bei ihm dreht sich alles um Startups, Digitalisierung und Unternehmertum. Weltweite Veranstaltungen und Coachings vor wichtigen Innovatorinnen und Innovatoren, Führungskräften und Mitarbeitenden von renommierten Unternehmen stehen bei ihm an der Tagesordnung. Im Interview verrät er, wie man das kurze Aufmerksamkeitszeitfensters der Person gegenüber in einem Pitch für sich gewinnen kann. Denn wie man so schön sagt: Der erste Eindruck zählt!
Herr Cronin, wie sind Sie zu Ihrem Titel „der Pitch Professor“ gekommen?
Daniel Cronin: Wenn ich diesen Titel höre, muss ich manchmal schmunzeln, da ich ein schlechter Schüler war. Mein Kopf war aber immer schon voller Ideen. Birgit Hofreiter, Director of Innovation Incubation Center der TU Wien, hat mir eines Tages zum Spaß einen Namensbutton verliehen, auf dem „Pitch Professor“ stand. Zwei Jahre später habe ich feierlich diesen Ehrentitel mit einer Urkunde verliehen bekommen. Es ist kein echter Titel. Ich habe ihn mir auch nicht selbst verliehen. Er entstand durch jahrelange Arbeit. Er gefällt mir sehr gut und bedeutet mir viel, obwohl ich eigentlich von Titeln nichts halte.
Können Sie sich noch an Ihren ersten Pitch erinnern? Was konnten Sie vor allem inhaltlich daraus mitnehmen?
Cronin: Bei meinem ersten professionellen Pitch konnte ich ein großes Learning für mich mitnehmen: „Keep it simple, und noch simpler!“. Ich habe diesen Pitch in Form einer sehr detaillierten Präsentation vorgestellt und war damit nicht erfolgreich. An diesem Tag habe ich verstanden, je höher die Position meines Gegenübers ist, desto weniger spielt Domain-Knowledge (Detailwissen) in einem ersten Gespräch eine Rolle. Es geht darum das große Bild grob vorzustellen und dann gegebenenfalls Expertinnen und Experten dazu zu holen. Wiliam Butler Yeats, einer der bedeutendsten englischsprachigen Schriftsteller, hat einmal gesagt:
„Denken Sie wie ein Weiser, aber sprechen Sie mit der Sprache der Menschen.“
Diese Aussage finde ich sehr smart. Ich kann nur empfehlen: Halten Sie den ersten Pitch immer simpel!
Sie haben im Laufe Ihrer Karriere viele Pitches gesehen und gehört. Welche Fragen sollte sich jedes Unternehmen stellen, bevor es beginnt an dem Inhalt eines perfekten Pitchs zu arbeiten?
Cronin: Bei einem Pitch sind zwei Dinge relevant: Zeit verdienen und Vertrauen aufbauen. Den perfekten Pitch gibt es nicht. Jedes Gespräch muss an die Situation angepasst werden. Dabei spielen drei Fragen (auf die die meisten keine Antwort haben) eine zentrale Rolle:
- Mit wem sprechen Sie?
- Wieviel Zeit haben Sie?
- Was möchten Sie damit erreichen?
Welche Zutaten sind für einen guten Inhalt in einem Pitch noch wichtig?
Cronin: Ein Pitch ist wie ein Date. Beim ersten Date geht es eigentlich nur darum: „Wird es ein zweites Date geben?“. In den meisten Fällen gibt es aber kein Zweites. Grob gesprochen hat ein Date das Ziel, sich in den ersten fünf Minuten ineinander zu verlieben. Dabei ist ein Schritt-für-Schritt-Denken fundamental. Im Normalfall geht man nicht gleich auf die Person zu und sagt: „Lass uns heiraten und Kinder kriegen?“. Das Gegenüber wäre mit dieser Frage überfordert, auch wenn es vielleicht das perfekte Date ist.
Der erste Gedanke bei einem Pitch sollte folgendermaßen lauten: „Ich hätte gerne von Ihnen zehn Minuten Zeit, um zu beweisen, dass das woran ich arbeite auch funktioniert!“. Es ist wichtig das Gespräch einfach zu halten, um eine Beziehung aufzubauen. Eine Beziehung basiert auf Vertrauen. Gleichzeitig muss man auch die Sprache des Gegenübers sprechen. Viele reden häufig aneinander vorbei.
Haben Sie eine bestimmte Struktur für einen Pitch immer vor Augen?
Cronin: Ich habe mir im Laufe der Jahre einen einfachen Aufbau für einen guten Pitch skizziert:
- Formulieren Sie in einem Satz, was Sie machen.
- Umreißen Sie kurz und prägnant das Problem. (Viele reden viel zu lange darüber.)
- Nennen sie eine beeindruckende Zahl, um Gehör zu finden (ich nenne das BFN = BIG F****** Number, da viele in diesem Moment Omnigramme und viel zu komplexe Informationen verwenden).
- Erzählen Sie davon: Wo stehen Sie mit Ihrer Vision heute?
- Erzählen Sie davon: Was sind die nächsten Schritte und Ziele?
- Bringen Sie die persönliche Komponente ein: Warum sprechen Sie heute mit ihrem Gegenüber?
Dieser Aufbau sieht anhand eines Beispiels folgendermaßen aus:
„Ich bin Daniel und Gründer von Shazam. Diese App erkennt Musik. Sie kennen dieses Problem sicher: Sie sitzen an der Bar und kennen den Titel des Songs nicht. Im Übrigen: So geht es 37.000 Millionen Menschen jeden Tag. Wenn Sie aber innerhalb von zehn Sekunden herausbekommen, wie der Song heißt, werden Sie ihn nicht nur herunterladen, sondern lebenslanger Fan werden.“
Im nächsten Schritt ist wichtig messerscharf die Lösung anzusprechen:
„Alles was Sie machen müssen ist das Handy herausholen, die App öffnen und auf den großen Knopf drücken.“
Am Ende ist es wichtig noch auf die Ziele einzugehen, denn auf diesen baut der Pitch auf:
„Zurzeit sind wir in einer Beta-Phase. Der nächste große Schritt ist der Markt in Deutschland. Das wird im Q2 2022 passieren. Und genau deswegen spreche ich heute mit Ihnen, damit wir gemeinsam den perfekten Market-Entry machen.“
Wie wichtig ist es Ihrer Meinung nach einen Elevator Pitch der eigenen Marketingstrategie immer gedanklich parat zu haben?
Cronin: Es ist immer wichtig mit extremen Fokus in ein Gespräch oder eine Präsentation zu gehen. Die Vision, an der gerade gearbeitet wird, muss messerscharf an das Gegenüber übermittelt werden. Der Begriff „Elevator Pitch“ entstand in den zwanziger Jahren in New York. Er basiert auf dem Szenario eine wichtige Persönlichkeit in einem Aufzug zu treffen und diese während der kurzen Dauer einer Aufzugsfahrt von der eigenen Idee zu überzeugen. Damals hatten hohe Häuser sehr langsame Fahrstühle. Dieses Prinzip ist für Europa nicht kompatibel. Durchschnittlich haben wir Häuser mit drei Stockwerke und schnelle Fahrstühle. Deshalb habe ich auch keinen bestimmten Begriff dafür. Mir ist aber wichtig, dass wenn jemand fragt: „Was machst du eigentlich?“, ich in der Lage bin kurz und präzise die Tätigkeit anzusprechen. Manchmal ergeben sich daraus gute Gespräche. Wichtig ist dabei alles so simpel wie möglich zu halten.
Welche Botschaft möchten Sie mit unseren Leserinnen und Lesern teilen?
Cronin: Ich hatte immer Angst vor Publikum zu sprechen. Mut bedeutet aber nicht keine Angst zu haben. Mut bedeutet Angst zu haben, aber sich trotzdem zu trauen. Ich dachte immer, dass Angst eine Schwäche ist. Angst ist normal. Natürlich habe ich Angst, wenn ich das erste Mal über meine Idee spreche. Ich empfehle immer die Ängste aufzuschreiben. Man kann sich in einem nächsten Schritt für jedes Problem Lösungen überlegen:
„Ich habe Angst, dass mein Mund beim Pitch trocken wird.“
Trink vorher etwas!
„Ich habe Angst, dass meine Stimme zittert!“
Mach bestimmte Übungen, die dir helfen besser damit umzugehen.
„Ich habe Angst, dass meine Ideen nicht gut ankommen.“
Sprich über deine Idee.
Bildquelle: Daniel Auer
Online-Texte, die im Internet gefunden werden sollen, benötigen eine SEO-Optimierung. Gelingt es Ihnen mit SEO-optimierten Texten eine Top-Position in den Suchergebnissen zu erobern, können Sie sich über regelmäßige Seitenbesuche freuen. Hier erfahren Sie, wie Sie in fünf Schritten einen gelungenen SEO-Text verfassen.
SEO-Texte sind Webtexte, die auf ein gutes Ranking (= Position in den Suchergebnissen) abzielen. Sie werden für Menschen geschrieben, die im Internet Informationen zu einem konkreten Problem suchen. Die Suchmaschinenoptimierung (SEO) verfolgt dabei das Ziel, die einzelnen Unterseiten einer Website mit passenden Keywords auszustatten und zu beschlagworten, damit Suchmaschinen diese verstehen, in einem Verzeichnis einordnen und bei entsprechenden Suchanfragen ausspielen können. Trifft hierbei der bereitgestellte Content die tatsächliche Suchintention („search intent“) der Userin oder des Users, erreicht die Website gute Platzierungen (Seite 1) in den Suchergebnissen (SERPs).
Neben dem Einsatz von Keywords gibt es auch andere SEO-Bausteine, die Sie berücksichtigen können: Aufbau und Struktur des Textes, Meta-Description, Alternative-Tags für die Bildbeschreibung oder Backlinks, also Link-Verweise anderer Websites auf Ihren Content. Diese Bausteine werden als Rankingfaktoren bezeichnet – je mehr der insgesamt rund 200 Rankingfaktoren berücksichtigt werden, desto zuverlässiger werden sich Ihre Bemühungen in den Key-Performance-Indicators (KPIs, deutsch: Leistungskennzahlen) widerspiegeln.
Keywords und Suchintention
Hinter jedem Keyword steht eine bestimmte Suchintention („search intent“), die von der Suchmaschine mithilfe von Algorithmen in der Regel richtig erraten wird. Suchintentionen lassen sich grob in drei Kategorien unterteilen:
- Know-Suche (informationsorientierte Suchbegriffe): In diese Kategorie fallen Suchanfragen, bei denen Userinnen und User etwas Bestimmtes wissen möchten. Das kann beispielsweise die Einwohnerzahl der Stadt Wien sein. Die gewünschte Information wird bei einfachen Fragen (auch Know-Simple-Suche) in einem eigenen Kasten oberhalb der normalen Suchergebnisse präsentiert. Die Suchanfrage kann zudem durch ein Featured Snippet, den Text-Auszug eines Artikels, beantwortet werden. Informationsorientierte Suchbegriffe sind die häufigsten Suchanfragen mit einem Anteil von 50 % bis 70 %.
- Do-Suche (transaktionsorientierte Suchbegriffe): Auf diese Kategorie von Suchanfragen folgt eine bestimmte Handlung am Ende der Recherche. Eine Person möchte beispielsweise ein bestimmtes Produkt kaufen, ein Musikvideo anschauen oder eine App herunterladen.
- Go-Suche (navigationsorientierte Suchbegriffe): Diese Suchanfragen dienen der Hilfe bei der Navigation und zeigen an, dass ein bestimmter Ort beziehungsweise der Weg dorthin gesucht wird. Navigationsorientierte Suchbegriffe beziehen sich auch auf Inhalte im Netz, wenn beispielsweise eine bestimmte Website gesucht wird.
SEO-Texte schreiben: 5 Schritte
1. Schritt: Fokus-Keyword definieren
Die Arbeit an einem SEO-optimierten Online-Text beginnt mit der Suche nach einem passsenden Keyword:
Wenn Sie sich für ein Fokus-Keyword entscheiden, haben Sie die Wahl zwischen Short-Tail-Keywords (1-2 Wörter) und Long-Tail-Keywords (ab 2 Wörtern, auch Frage-Sätze). Short-Tail Keywords zeichnen sich durch ein hohes Suchvolumen (monatliche Suchanfragen für einen bestimmten Begriff) und einer hohen Konkurrenz im Netz aus. Außerdem ist hier die Suchintention nicht immer eindeutig: Das Keyword „Italien“ kann sowohl eine informations-, transaktions-, als auch navigationsorientierte Suchintention darstellen.
In vielen Fällen ist es daher zielführender, sich für ein Long-Tail-Keyword zu entscheiden. Diese werden zwar seltener in der Suchmaschine eingegeben, bieten jedoch bessere Chancen für ein gutes Ranking und echte Seitenbesucherinnen und -besucher, die nicht gleich wieder abspringen (Bounce Rate, Absprungrate), sofern Ihr Content nicht den konkreten Bedürfnissen der Userin oder des Users entspricht. Das Fokus-Keyword für den vorliegenden Text lautet „SEO Texte schreiben“.
Worauf Sie im Rahmen Ihrer Keyword-Recherche sonst noch achten können, erfahren Sie im Beitrag: „SEO: So gelingt die Keyword-Recherche“.
2. Schritt: Best Practice: Die ersten Suchergebnisse analysieren
Spätestens jetzt sollten Sie sich einen Überblick zum vorhandenen Content-Angebot für das jeweilige Thema im Netz verschaffen. Hierbei sollten Sie sich die Frage stellen, warum diese Artikel gute Platzierungen (beispielsweise die ersten fünf organischen, also unbezahlten Suchergebnisse) in den Suchergebnissen erzielen und wie die gesuchten Informationen darin aufbereitet werden.
Achtung: Wer andere imitiert, verliert seine eigene Orientierung. Versuchen Sie herauszufiltern, was die Konkurrenz gut macht. Kombinieren Sie die gewonnen Erkenntnisse mit einer neuen Herangehensweise und fügen Sie Ihrem Content neue Elemente hinzu (zum Beispiel: Visual Content, Interviews, neue Perspektiven auf das Thema).
Ein Glückstreffer: Vielleicht gelingt es Ihnen, über ein Thema zu schreiben, wonach gesucht wird, aber zu dem noch kein entsprechendes Angebot im Netz zu finden ist. Ihre Pionierarbeit wird rasch mit vielen Seitenaufrufen belohnt werden.
3. Schritt: Die gelungene Online-Recherche
Jede Online-Recherche ist mit einer bestimmten Herausforderung verbunden: Wie lässt sich aus einer unüberschaubar großen Menge an Information die beste und vertrauenswürdigste herausfiltern? Um Fallstricke im Zuge der Recherche zu vermeiden, sollten Sie möglichst systematisch arbeiten und folgende Punkte beachten:
- Verschiedene Suchbegriffe verwenden: Geben Sie im Rahmen Ihrer Recherche möglichst verschiedene sinnverwandte Begriffe oder Synonyme in die Suchleiste ein. Verwenden Sie dabei auch Suchoperatoren, mit denen Sie Ihre Suche verfeinern können. Zu guter Letzt sollten Sie organische Suchergebnisse (keine bezahlten Anzeigen) bevorzugen und auch die hinteren Ergebnisseiten durchklicken. Neben Google können Sie außerdem auch andere Suchmaschinen im Zuge Ihrer Recherche einsetzen.
- Inhalte kritisch bewerten: Um seriöse Inhalte rasch von unseriösen unterscheiden zu können, ist es hilfreich, grundlegende W-Fragen in Bezug auf den Inhalt zu stellen. Überprüfen Sie beispielsweise, wer für eine Website beziehungsweise wer für den jeweiligen Artikel verantwortlich ist. Auch die Aktualität der Internetquelle (Veröffentlichungsdatum) ist für viele Themengebiete von hoher Relevanz.
- Quellen dokumentieren: Um in Zweifelsfall Informationen überprüfen zu können, können Sie die verwendeten Suchbegriffe sowie relevante Links und PDFs mit einem Datum notieren und in einem Word-Dokument speichern.
Näherer Informationen darüber, wie Sie beim Recherchieren im Netz vorgehen können, erfahren Sie in unserem Beitrag „Corporate Blog: Tipps für eine gute Recherche“.
4. Schritt: Struktur und Verlinkung
Lassen Sie sich Zeit beim Formulieren der Zwischenüberschriften. Diese sollten:
- SEO-optimiert sein, daher auch Keywords enthalten
- möglichst konkret klarmachen, was die Leserschaft in Bezug auf den Absatz erwarten kann, und
- logisch aufgebaut sein.
Platzieren Sie Absätze mit zentralen Informationen zum Thema beziehungsweise zum Kernproblem nach Möglichkeit weit oben im Text. Die Online-Welt ist ungeduldig: Findet eine Person nicht mit wenigen Blicken die versprochene Information, wird sie höchstwahrscheinlich die Seite schließen und weitersuchen. Die Folge: Eine höhere Bounce-Rate und eine schlechtere User Experience. Die Suchmaschine berücksichtigt das bisherige Verhalten der Userin oder des Users, wenn es darum geht, diesen Artikel ein zweites Mal bei exakt demselben Suchbegriff auszuspielen.
Überschriften (H1, H2, H3, H4, H5) sollten im Sinne eines logischen Aufbaus hierarchisch strukturiert sein. Schenken Sie außerdem der internen Verlinkung Ihre besondere Aufmerksamkeit: Wenn Sie bereits Artikel auf Ihrer Website oder Ihrem Blog veröffentlich haben, versuchen Sie, auf diese zu verlinken und vice versa.
5. Schritt: Einen Online-Text verfassen
Bevor Sie mit dem Schreiben beginnen, sollte Ihnen klar sein, für welche Zielgruppe Sie schreiben. Denn davon hängt ab, ob Sie Ihre Leserschaft mit einem höflichen „Sie“ oder einem amikalen „Du“ ansprechen wollen. Berücksichtigen Sie Ihre Zielgruppe hinsichtlich der Wortwahl und des Schreibstils. Wenn Sie ein fachspezifisches Thema für ein breit gestreutes Publikum abhandeln, können Sie Fachbegriffe und Fremdwörter gerne näher erläutern. Lesen Sie zu diesem Thema auch unseren Beitrag „Personas: So verleihen Sie Ihrer Zielgruppe Charakter“.
Für die Textproduktion ist das Hamburger Verständlichkeitsmodell nach wie vor richtungsweisend. Das Konzept beschreibt Regeln für einen klar verständlichen Text und empfiehlt beispielsweise möglichst kurze Sätze. Passivkonstruktionen, Nominalstil (Substantivierungen) und lange Schachtelsätze sollten Sie hingegen vermeiden, da sie den Text häufig komplizierter machen als notwendig.
Nachdem Sie die erste Rohfassung Ihres SEO-Textes geschrieben haben, beginnt die Überarbeitung. Mithilfe von Korrekturschleifen nach dem 4-Augenprinzip gewinnen Texte so gut wie immer an Qualität.
SEO Texte schreiben: Tools und Hilfsmittel
SEO-Texte können Sie prinzipiell auch ohne Tools und Hilfsmittel schreiben – abgesehen von Informationen, die Sie direkt von einer Suchmaschine beziehen können (zum Beispiel bei Google: „Verwandte Suchanfragen“, bei Bling: „Ähnliche Suchvorgänge“). Dabei verzichten Sie jedoch auf wichtige Einblicke wie zum Beispiel Suchvolumen, Konkurrenz, erweiterte Keyword-Vorschläge, WDF*IDF-Analysen (Termgewichtungsanalysen, Verteilung themenrelevanter Begriffe innerhalb eines Textes), User-Metrik. Insbesondere wenn Sie Ihren Content in einem laufenden Prozess optimieren wollen, benötigen Sie die Hilfe spezialisierter Online-Tools:
Kostenlos:
- Free Keyword Generator: Das kostenlose Online-Tool eignet sich für die Keyword-Recherche.
- Google Search Console: Die Search Console ist nach wie vor das Nonplusultra für die SEO-Optimierung einzelner Texte, die sich auf einer Website befinden. Analysiert wird hierbei der Traffic (Seitenbesucher) Ihrer Website beziehungsweise auch andere wichtige KPIs. Diese Daten erlauben Rückschlüsse auf Schwachstellen und Verbesserungsmöglichkeiten.
- Google Ads: Das Tool richtet sich in erster Linie an Personen, die Anzeigen schalten beziehungsweise Suchmaschinenwerbung (SEA) betreiben wollen. Darüber hinaus können Sie mit dem Keyword-Planner Schlüsselbegriffe recherchieren.
Kostenpflichtig:
- Ryte.com: Mit Ryte können Sie Ihre Website analysieren, Schwachstellen identifizieren und die User Experience verbessern. Für eine umfassende SEO-Arbeit bietet Ryte außerdem die Möglichkeit, die beiden Google-Tools Search Console und Analytics zu implementieren.
- Sistrix.de: Sistrix bietet anschauliche Analysen in Bezug auf die gesamte Website im Verhältnis zu konkurrierenden Websites.
- Seolyze.com: Das Online-Tool bietet semantische Textanalysen für Web-Inhalte (WDF*IDF-Analysen) und zeigt an, welche wichtigen Schlüsselbegriffe in einem Text vorkommen sollten. Somit eignet sich Seolyze insbesondere für die textliche Optimierung des bestehenden Contents.
SEO-Texte optimieren: ein laufender Prozess
Sie haben Ihren SEO-optimierten Text veröffentlicht? Sehr gut. Nun beginnt allerdings der zweite Teil der Suchmaschinenoptimierung: die Beobachtung (Monitoring) und Optimierung Ihres Contents. Wenn Sie beispielsweise feststellen, dass sich Userinnen und User für einen bestimmten Aspekt Ihres bereitgestellten Contents interessieren, sollten Sie sich überlegen, diesen Aspekt näher zu behandeln. Überarbeitungen und Content-Pflege – beispielsweise für sogenannten „Evergreen-Content“, der nicht oder im Laufe der Zeit nur wenig an Aktualität verliert – sind wichtige Eckpfeiler der Suchmaschinenoptimierung und sorgen für die Traffic-Steigerung. SEO-Arbeit ist daher, wie jede Optimierung, ein laufender Prozess ohne Deadline. Denn die Konkurrenz schläft nicht.
Bildquelle: pixabay.com
Beim Lesen einer Zeitung, einer Zeitschrift oder eines Magazins – egal ob print oder online – haben Sie es vermutlich schon einmal gesehen: Ein Advertorial. Also einen Beitrag, der optisch wie ein Artikel des jeweiligen Mediums aussieht, inhaltlich jedoch ein PR-Artikel ist. Wir haben Tipps, wie Sie gute Advertorials verfassen.
Der Ausdruck „Advertorial“ ist eine Wortschöpfung, zusammengesetzt aus den englischen Begriffen „Advertisement“ (Deutsch: Werbeanzeige) und „Editorial“ (Leitartikel oder Vorwort), und kennzeichnet eine besondere Art der Werbeeinschaltung: Ein Advertorial ist bezahlte Werbung für ein Produkt oder einen Service, aber – und das ist der große Unterschied zu einer herkömmlichen Anzeige – in redaktioneller Aufmachung.
Durch die Verbindung der Aspekte Werbung und redaktionelle Optik wird ein Advertorial auf den ersten Blick also nicht als Werbung wahrgenommen. Da der Unterschied beim flüchtigen Betrachten oft nicht sofort erkennbar ist, ihm von Leserinnen und Lesern deshalb sogar mehr Aufmerksamkeit geschenkt wird, ist es umso wichtiger, dass ein Advertorial eindeutig als solches gekennzeichnet ist. Advertorials müssen klar durch einen schriftlichen Zusatz wie „Werbung“, „Promotion“ oder „entgeltliche Schaltung“ erkennbar sein, um die Trennung von unabhängiger Redaktion und bezahlter Kommunikation zu gewährleisten. Wird ein bezahlter Text in einem Print- oder Online-Medium nicht klar gekennzeichnet, liegt ein Verstoß vor. Außerdem leidet die Glaubwürdigkeit des Medien-Unternehmens.
Advertorials sind beliebt – warum?
Egal ob in einem Print-Produkt oder online – Advertorials sind weit verbreitet und als ein Bestandteil im Mix der verschiedenen Werbemaßnahmen sehr beliebt. Denn die Werbewirkung eines Advertorials, das Werbeinhalte in einem redaktionellen Umfeld präsentiert und somit viele Leserinnen und Leser zielgenau mit wichtigen Informationen erreicht, ist enorm.
Ein klassisches Inserat besteht meist aus einem großen Bild und enthält nur die wichtigsten Informationen, die man an die potenziellen Kundinnen und Kunden bringen will. Im Unterschied dazu hat das Advertorial einen größeren Wortanteil und durch informative Inhalte das Potenzial, die Aufmerksamkeit der Leserinnen und Leser zu fesseln. Doch um diesen Vorteil gegenüber einer klassischen Werbeanzeige – die natürlich weiterhin ihre Berechtigung hat – ausspielen zu können, müssen Advertorials gezielt eingesetzt werden und Gestaltung sowie Inhalt überzeugen.
So gelingt ein gutes Advertorial
Botschaften, die in eine gute Geschichte verpackt werden, erzeugen mehr Aufmerksamkeit. Damit ein journalistisch gestalteter PR-Artikel also seine volle Wirkung entfaltet, und Inhalt und Informationen bei der gewünschten Zielgruppe ankommen, sind gutes Storytelling und inhaltlicher Mehrwert gefragt.
- Mit inhaltlicher Stärke die Neugierde wecken
Statt die Leserin und den Leser mit offensichtlichen Werbeinhalten zu langweiligen, gilt es, mit einer inhaltlich starken und interessanten Story zu fesseln und die Neugierde zu wecken. Das kann durch eine journalistische Herangehensweise gelingen: Am Beginn steht ein starker und sprachlich gut formulierter Einstieg, der die Kernbotschaft beinhaltet.
- W-Fragen beantworten, kurze und prägnante Sätze
Auch müssen zu Beginn die W-Fragen (wer, wann, wie, wo, was und warum) beantwortet werden, um vollständig und informativ zu sein. Sowohl die Sätze als auch der ganze Text sollen nicht zu lang sein, damit ein Lesefluss entsteht und Leserinnen und Leser nicht abspringen.
- Zitate lockern den Text auf
Empfehlenswert ist auch, authentische Zitate der handelnden Personen einzubauen. Sogenannte O-Töne von Interviewpartnerinnen und Interviewpartnern lockern den Text auf und sind gleichzeitig packender als die indirekte Rede.
- Anpassen an das redaktionelle Umfeld und Medium
Insgesamt gilt es, sich bei der Gestaltung und dem Stil des Advertorials an das Medium anzupassen, in dem es erscheint. Das gilt natürlich auch für die Auswahl der Bilder, die für den Artikel verwendet werden. Die Fotos zum Text sollen zum Medium passen und viel Aufmerksamkeit wecken – und somit Lust aufs Lesen des Advertorials machen.
Ein Advertorial kann also unter bestimmten Voraussetzungen eine gute und effektive Alternative zu einem Inserat sein. Es wird gesehen, es wird gelesen und kommt demnach – entsprechend gekennzeichnet natürlich – bei den Leserinnen und Lesern an.
Bildquelle: Adobe Stock – onephoto
Viele Unternehmen kehren nach Corona nicht mehr gänzlich ins Büro zurück. Auf Videokonferenz-Tools wie Zoom werden sie deshalb auch in Zukunft nicht verzichten können. Durch die Erfahrungen während der Corona-Pandemie konnten die Videocall-Systeme gleichzeitig immer weiter verbessert werden: Mittlerweile setzen sich in der breiten Masse neben Zoom vielversprechende Alternativen für virtuelle Besprechungen durch.
Videokonferenzsysteme wie Zoom und Teams haben Unternehmen sicher durch die Krisenzeiten gebracht und den Austausch mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Homeoffice trotz Social Distancing erleichtert. Aber nicht nur in Pandemiezeiten bieten Onlinemeetings diverse Vorteile: Standortunabhängig miteinander in Kontakt zu treten spart Kosten und Zeit, wodurch wiederum Arbeitsprozesse effizienter abgewickelt werden können. Darüber hinaus hat die Coronakrise einen radikalen Wandel im Arbeitsleben angestoßen und der Trend zum Homeoffice wird auch weiterhin wachsen. Dieser Blogpost zeigt Ihnen hilfreiche Videokonferenz-Systeme neben Zoom und Co.
Whereby
Das norwegische Videokonferenz-Tool Whereby ist in Kostenfragen noch ein Geheimtipp, obwohl es bereits 2013 gelauncht wurde. Mit der kostenfreien Version der Software können bis zu vier Personen an einem Videochat teilnehmen, aber auch die erweiterte Version für größere Gruppen ist schon ab etwa sechs Euro im Monat erhältlich. Praktisch daran ist, dass es für den Videocall keiner Installation bedarf, sondern die Video-Meetings über einen nutzerdefinierten Link direkt im Browser betreten werden können – vom PC oder Mobilgerät aus. Ein eigenes Profil anzulegen ist nicht notwendig. Und auch in Sicherheitsfragen tut sich das Onlinemeeting-Tool positiv hervor: In beiden Versionen sind die Sessions verschlüsselt. In der Pro-Version können zudem Layout und Chat passend zum Corporate Design des Unternehmens verändert werden und auch Gäste, etwa Kundinnen und Kunden, ohne Login teilnehmen.
GoToMeeting
Seit 2019 gibt es bei GoToMeeting eine Menge neuer Funktionen: Das System läuft mittlerweile über Browser, Desktop- und Mobile-App und auch an der Geschwindigkeit beim Starten von Meetings hat GoToMeeting laut Hersteller gearbeitet. Bei Videokonferenzen kann ähnlich wie bei Zoom oder Teams der Bildschirm mit anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern geteilt werden. Bei der Starter-Version um 24 Euro monatlich sind Meetings mit bis zu zehn Personen möglich, ab 36 Euro monatlich sind es bis zu 150. Auch bei GoToMeeting ist keine Anmeldung erforderlich und der Verbindungsweg ist End-to-End verschlüsselt, für Dritte also nicht einsehbar. Außerdem bietet das Unternehmen Schulungen an, um die Nutzung zu erlernen.
Google Meet
Für Google-Verhältnisse stieg der Konzern relativ spät in den Videokonferenzen-Markt ein: 2013 war das Tool unter dem Namen Google Hangouts für Unternehmen konzipiert worden, die schon mit dem Google Office-Produkt Workspace arbeiteten. Seit 2020 können alle Personen kostenlos Videokonferenzen erstellen: Die Videocalls laufen für bis zu 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmern und für maximal eine Stunde direkt im Browser. Eine Voraussetzung, um das Tool verwenden zu können, ist allerdings ein Google-Konto. Für größere Besprechungsgruppen gibt es Bezahl-Abos ab acht Euro monatlich. Google Meet lässt sich zudem mit vielen anderen Google-Diensten wie dem Kalender bis zu Google Docs verbinden. Und es funktioniert sowohl mit Android als auch mit iOS. Das Google-Programm zeichnete sich schon früh durch ein hohes Maß an Sicherheitsmaßnahmen aus, die mittlerweile allerdings auch Zoom und Teams integriert haben: Die Datenübertragung ist standardmäßig verschlüsselt. Einzig bei der telefonischen Teilnahme an einer Videokonferenz weist das Unternehmen darauf hin, dass die Übertragung von Audiodateien über das Telefonnetz nicht hundertprozentig sicher ist
Jitsi Meet
Jitsi Meet funktioniert auf Open-Source-Basis und macht es Nutzerinnen und Nutzern möglich, kostenfrei direkt im Browser an virtuellen Besprechungen teilzunehmen und auch den Bildschirm zu teilen. Auch hier sind keine individuellen Nutzerdaten oder Softwareinstallationen nötig. Teilnehmerinnen und Teilnehmer können über eine spezifisch erstellte URL ins Meeting einsteigen. Ein Pluspunkt ist, dass sich die einzelnen Meetings mit einem Passwort sichern lassen. Im Gegensatz zu anderen Konferenzsystemen sind die Konferenzräume allerdings zeitlich begrenzt: Sie existieren nur für die Dauer des Meetings und verschwinden, sobald die letzte Person es verlassen hat. An einem Videocall können bis zu 100 Personen teilnehmen, wobei empfohlen wird, die Anzahl auf etwa 30 Teilnehmende zu begrenzen, da sonst die Videoqualität leidet. Genutzt werden kann Jitsi Meet sowohl als Web-App als auch auf Android und iOS-Geräten. Eine End-to-End-Verschlüsselung ist möglich, muss allerdings im Menü explizit aktiviert werden.
TeamViewer Meeting
TeamViewer ist ein alter Hase auf dem Markt, der bereits 2005 als Software für den Fernzugriff erschien. Sukzessive baute das Unternehmen sein Kernprodukt aus, sodass es mittlerweile neben Fernsteuerung und Fernwartung von Computern auch ein sich immer größerer Beliebtheit erfreuendes Tool für Onlinemeetings anbietet. Für bis zu fünf Personen ist die Nutzung kostenlos, die Tarife für die kommerzielle Nutzung betragen zwischen 60 Euro (kleines Paket) und etwa 130 Euro (großes Paket) im Monat. Wer die Software auf Desktop, Mobilgerät und Computer installiert hat, kann an Videokonferenzen mit bis zu 300 Userinnen und Usern teilnehmen und darf mit der Verschlüsselung alle heutigen Sicherheitsstandards erwarten.
Ob Jitsi Meet oder Whereby: Durch die Pandemie sind viele verschiedene Alternativen zu Zoom und Teams in der Mitte der Gesellschaft angekommen, die sich nach besonderen Anforderungen und Zwecken der einzelnen Unternehmen richten. Es gilt am Ende nur, durch Ausprobieren das passende Programm zu finden.
Bildquelle: unsplash.com
Seit Silicon Valley ist Künstliche Intelligenz aus der Tech-Welt nicht mehr wegzudenken. Fast jedes Unternehmen setzt heutzutage auf intelligente Systeme, um die zunehmende Komplexität der Social-Media-Kanäle zu optimieren.
Playlist-Vorschläge auf Spotify, Film-Empfehlungen beim Netflix-Abend oder Reise-Tipps, weil man „Mallorca“ gegoogelt hat. Wer soziale Netzwerke, Suchmaschinen oder Streaming-Dienste nutzt, stärkt den Online-Wettbewerb und damit den zunehmenden Einsatz der künstlichen Intelligenz. Algorithmen filtern, was wir ansehen, hören oder kaufen. Firmen müssen sich deshalb Strategien überlegen, wie sie möglichst viele Kundinnen und Kunden auf ihre Webseite locken. Gegenwärtig wird auch im Social Media Marketing auf Künstliche Intelligenz (KI) gesetzt. Wie das genau abläuft, zeigen wir Ihnen im folgenden Blogpost.
Welche Möglichkeiten bieten KI-Tools im Social Media Management?
Unternehmen, die ein erfolgreiches Social Media Marketing führen möchten, nutzen im Idealfall intelligente Systeme für die Datenverarbeitung ihrer Kundinnen und Kunden. Die sogenannten „KI-Tools“ sind Werkzeuge, die der Social Media-Abteilung helfen relevante Dateninformationen zu sammeln und zu interpretieren. Sie erfassen wie die Personen in den sozialen Netzwerken interagieren und kommunizieren. Die Analyse des Nutzerverhaltens hilft bei der Weiterverfolgung aktueller Trends und kann für Marketing-Zwecke genutzt werden.
Das bedeutet für den Online-Wettbewerb: Je umfangreicher der Einsatz dieser Systeme, desto erfolgreicher lässt sich Werbung und Produktvermarktung auf die Kundschaft abstimmen. Andernfalls könnten Marketingabteilungen großer Konzerne mit der ansteigenden Flut an Likes, Kommentaren und Verlinkungen in absehbarer Zeit überfordert sein.
Wie verhalten sich Userinnen und User auf dem jeweiligen Social-Media-Kanal? Welche Inhalte werden konsumiert? Was sind die neuesten Trends und welche Werbe-Strategien lassen sich aus den Verhaltensweisen der potenziellen Kundinnen und Kunden ableiten? Marketingteams müssen sich mit vielen Fragen auseinandersetzen. In den letzten fünf Jahren gab es im Bereich der künstlichen Intelligenz eine enorme Entwicklung, sodass diese Fragen heute relativ einfach mit deren Hilfe beantwortet werden können. Ein Teilgebiet der KI, das dazu imstande ist, ist beispielsweise das „Machine Learning“. Dabei erkennen die intelligenten Werkzeuge durch Algorithmen Muster und Gewohnheiten der Userinnen und User. Diese werden in Datensätzen angelegt und gespeichert. So sparen Unternehmen viel Zeit und Arbeit. Die KI erkennt was Userinnen und User ansehen, liken, teilen und kommentieren. Diese Informationen werden gesammelt und geben Aufschluss über die Wünsche und Interessen der Zielgruppen. Marketingabteilungen erhalten so Einblicke in die Vorlieben potenzieller Kundinnen und Kunden. Dies wiederum gibt ein klareres Bild darüber, wie der personalisierte Content aussehen muss, um die Zielgruppe anzusprechen. Je mehr Daten vorhanden sind, desto individueller können die gewünschten Leistungen zugeschnitten werden. Das stärkt die Bindung der Nutzerinnen und Nutzern zur Marke und damit auch zum Unternehmen.
KI-Tools übernehmen also routinierte Marketing-Aufgaben, reduzieren dadurch den zeitlichen Aufwand und anfallende Kosten. Sie adressieren via Facebook, Instagram, TikTok und Co. direkt die Zielgruppe des Unternehmens. Größere Unternehmen haben in der Regel mehr Kapital, um in intelligente Systeme zu investieren und auch nachhaltig damit zu arbeiten. Im Print-Marketing oder in der Außenwerbung (Werbung im öffentlichen Raum) steht der Einsatz von KI-Tools noch am Anfang. Daher beschränken wir uns in diesem Blogartikel auf die Plattform Instagram und den Bereich des Community Managements.
Wie die Mode-Industrie Instagram für sich nutzt
Instagram ist ein Social Media-Kanal, der von Mode-Unternehmen gerne zur Eigenvermarktung und zur Präsentation ihrer Produkte genutzt wird. Hier haben sie den Zugriff auf öffentliche Instagram-Profile der international bekanntesten Influencerinnen und Influencer, Models oder Celebrities. Mit einer gewaltigen Zahl an Followerinnen und Followern stehen diese Personen repräsentativ für eine ganze Generation. Sie sind stylisch, modern, reisen um den Globus und sind auf den exklusivsten Veranstaltungen anzutreffen. Ihre Postings bieten aber häufig auch ein enormes Identifikationspotential für Milliarden von Followerinnen und Followern. Und genau das bleibt auch der Lifestyle- und Fashionwelt nicht verborgen.
Die KI-basierte Marktforschung der Social Media Plattform erkennt und filtert, per Foto- und Videoerkennung welche Kleidungsstücke oder Beautyprodukte jene Personen tragen und speichert diese Informationen. Neben der visuellen Erkennung wird etwa bei Instagram-Reels auch die Stimmlage und Wortwahl, der sich darstellenden Personen analysiert, um Gefühlsempfindungen zu prüfen. Dadurch kann gezielt das Konsumverhalten der Kundinnen und Kunden analysiert werden, die sich an den Styles der Influencerinnen und Influencer orientieren. Mode-Konzerne nutzen diese Strategie für eigene Werbe-Konzepte und Marketing-Strategien. Auch hier gilt: Je mehr Datensätze der Influencerinnen und Influencer gespeichert werden, desto effektiver die Auswertung. Ziel ist es Models, Influencerinnen und Influencer für die eigene Werbekampagne zu gewinnen, damit diese Personen für die Verkaufsprodukte werben.
KI-Tools gegen Hate-Speech
Nicht nur die Modebranche profitiert vom Einsatz der intelligenten Systeme. Medienunternehmen, die ein ausgeprägtes Community Management führen, nutzen die künstliche Intelligenz unter anderem, um Diskussionen in Foren zu moderieren. Das KI-System erkennt Personen, die etwa negative Kommentare, Fake News oder Verschwörungstheorien verbreiten und sperrt diese automatisch. Auch die User-Kommentare werden durch KI-Tools analysiert und gegebenenfalls gelöscht.
Das Vorgehen wird von Medienunternehmen unterschiedlich, je nach deren Community-Richtlinien ihrer Netiquette, gehandhabt. Darin wird häufig auf einen respektvollen Umgang und konstruktive Argumente hingewiesen. Hitzige Debatten werden durch automatisierte Redewendungen beschwichtigt. Als Beispiel: „Bitte formulieren Sie Kritik sachlich und differenziert. Danke, die Redaktion XY“. Dadurch wird den Community-Teams aufwändige Arbeit abgenommen und der Fokus richtet sich auf einen sachlichen Meinungsaustausch in den Online-Gesprächen.
Nützliche KI-Tools für Marketing-Strategien
Jedes Unternehmen hat diverse Anforderungen für Ihr Social Media Management. Es gibt unzählige Tools, die verschiedene Funktionen erfüllen, Marketing-Strategien erleichtern und erfolgreiche Werbekampagnen garantieren. Im Folgenden werden nun drei sehr hilfreiche KI-Tools genauer erläutert.
- Dash Hudson: Dieses Tool ist speziell für visuelle Inhalte geeignet. Das Werkzeug analysiert Trends hinsichtlich der Foto- und Videogestaltung, wie Farbwahl und Textstil, sodass Unternehmen gezielt visuelle Inhalte nach Trends ausrichten können.
- Phrasee: Phrasee hilft bei der Erstellung von Marketingtexten, indem es sie auf ihren Erfolg prüft. Dabei wird durch Analysen herausgefiltert, welche Botschaft in welchem Format bei Ihrer Zielgruppe besonders gut funktioniert.
- Brand24: Das Tool Brand24 gibt Aufschluss darüber, wo Ihr Unternehmen oder Ihre Marke erwähnt wurde. Es analysiert Hashtags und Schlüsselwörter und zeigt in welchem Zusammenhang diese erstellt wurden. Das offenbart wie die Öffentlichkeit über Ihr Unternehmen oder ihre Marke denkt.
Achtung!
Sobald Userinnen und User jedoch ihre persönlichen Informationen in den sozialen Medien reduzieren, können die KI-Algorithmen Verhalten und Interessen nicht mehr nachvollziehen. Das bedeutet, dass eben jene Daten nicht mehr für personalisierte Werbung weiterverwendet werden können. Wer etwa auf Social Media-Plattformen zu übereilt gesetzlichen Vereinbarungen zustimmt, verzichtet außerdem häufig auf Rechte wie den Schutz der eigenen Daten. Userinnen und User sollten daher vor der Nutzung individuell reflektieren, womit sie sich im Online-Alltag wohlfühlen und dementsprechend agieren.
Bildquelle: unsplash.com
Eine ausdrucksstarke Titelseite ist mitunter ausschlaggebend für den Erfolg eines Magazins auf dem Markt und gegenüber der Konkurrenz. Ihre Erstellung ist jedoch oft eine echte Herausforderung. Wir geben Ihnen Tipps, wie sie dennoch gelingt.
Dass der erste Eindruck in jeder Situation einen entscheidenden Einfluss auf unsere Handlungen hat, trifft auch auf die Wahl eines Magazins anhand seines Covers zu. Müssen sich potenzielle Leserinnen und Leser zwischen verschiedenen, ihnen noch unbekannten Magazinen entscheiden, wählen Sie jenes, dass für ihren Geschmack am ansprechendsten wirkt. Das kann unter anderem an den verwendeten Farben, den Bildern oder neugierig machenden Artikel-Teasern liegen. Viele eindrucksvoll gestaltete Cover, die im Laufe der Jahre gedruckt wurden, schrieben dabei sogar Geschichte. Eine der wohl berühmtesten Frontseiten ist etwa jene des National Geographic Magazins von Juni 1985, das ein Foto des grünäugigen afghanischen Flüchtlingsmädchens Sharbat Gula – eine Aufnahme des Fotografen Steve McCurry – zeigt. Dieses und andere Magazine entwickelten sich dank ihres außergewöhnlichen Covers zu Sammlerstücken, die heute zu weit höheren Preisen als dem ursprünglichen Wert der Zeitschrift gehandelt werden. Auch wenn nur wenige Titelseiten mittlerweile weltberühmt sind, können für die Zielgruppe attraktiv gestaltete Coverseiten dennoch Auswirkungen auf die Zahl der Leserinnen und Leser haben. Zeit in die Gestaltung zu investieren, rechnet sich für Unternehmen daher allemal. Wir zeigen Ihnen, worauf zu achten ist.
Von Farben und Formen
Wen soll Ihr Magazin-Cover ansprechen? Und wie präsentiert sich Ihre Konkurrenz? Die Titelseite muss so gestaltet werden, dass Angehörige Ihrer Zielgruppe den Wunsch verspüren, die Zeitschrift zu öffnen und zu lesen. Zudem sollte sie sich klar und deutlich von anderen Magazinen derselben Sparte abheben. Bevor Sie daher mit Ihrem ersten Cover beginnen, machen Sie eine Zielgruppen- und eine Konkurrenzanalyse und erstellen Sie gegebenenfalls Personas, um ihrer zukünftigen Leserschaft Charakter zu verleihen. Ziel ist es herauszufinden, welche Bedürfnisse Ihre potenziellen Leserinnen und Leser haben und was sie von einem Magazin-Cover erwarten.
Die Farben
Im Erstellungsprozess muss dabei unter anderem nicht nur auf die Farbwahl geachtet werden, sondern auch auf die Bildsprache. Diese beiden Komponenten stellen in erster Linie den Blickfang eines Magazin-Covers dar. Um ein Gefühl für das angestrebte Design des Magazins zu bekommen, ist es hilfreich, ein Moodboard, das etwa Farbproben, Beispiel-Fotos und -Texte enthält, zu erstellen und gegebenenfalls auch die Corporate Identity des Unternehmens zu Rate zu ziehen. Daraus und aus der thematischen Ausrichtung Ihres Magazins ergibt sich die Farbwelt, in der sich das Cover bewegen soll. Harmonische Farbkombinationen können sowohl intensive Signalfarben wie auch gedeckte Töne umfassen – der Adobe Farbpaletten-Generator hilft bei der Zusammenstellung. Überlegen Sie also, welche Themen Ihr Magazin behandelt und wählen Sie dementsprechend eine passende Farbwelt, die auch zur farblichen Ausrichtung Ihres Unternehmens passt. Als Beispiel:
- Veröffentlichen Sie beispielsweise ein Magazin, das sich um die Themen Natur und Umwelt dreht, sind Grüntöne eine gute Wahl. Ein bekannter Vertreter ist hier etwa das GEO Magazin.
- Die Farbe Rot zieht als Signalfarbe die Aufmerksamkeit ganz besonders auf sich, weshalb sie viele Magazine auf ihren Coverseiten verwenden – Beispiele dafür sind etwa das österreichische Nachrichtenmagazin Profil oder die Wochenzeitschrift News.
- Das Feel-good-Magazin Flow vermittelt seine Ausrichtung durch zurückhaltende, aber dennoch bunte und lebensfrohe Titelseiten.
- Unser Verwaltungsmagazin „Die Republik“ zeigt durch sein klares und unverblümtes Auftreten den Charakter des behördlichen Umfeldes.
ACHTUNG
Üblicherweise werden CMYK-Farben für den Druck verwendet. Besonders grelle Neon- oder Metallicfarben lassen sich durch sie allerdings nicht gut darstellen. Wollen Sie dennoch Akzente in neon oder metallic auf Ihrem Magazin-Cover setzen, kommen sogenannte Sonder- oder Volltonfarben zum Einsatz, die ein anderes (jedoch nicht zwingend teureres) Druckverfahren erfordern.
Das Bild
Häufig geben sogenannte Aufmacher-Bilder schon erste Informationen zum Inhalt des Hefts. Ist die Titelstory beispielsweise ein Interview mit einer bekannten Persönlichkeit, ist diese nicht selten Thema des Cover-Fotos. So wissen potenzielle Leserinnen und Leser auf den ersten Blick, dass der wichtigste Artikel des Magazins in Zusammenhang mit dem steht, was diese Person vertritt. Sie sollten hier jedoch unbedingt darauf achten, dass ihr Fotomotiv direkt in die Kamera blickt und so Augenkontakt mit Ihrem Publikum aufnimmt. Denken Sie beispielsweise an das eingangs erwähnte afghanische Flüchtlingsmädchen auf dem National Geographic Cover: Ihre grünen Augen starren Leserinnen und Leser des Magazins vor dem Aufschlagen förmlich an. Was fühlen Sie, wenn Sie ihren starken Blick erwidern? Eine weitere wichtige Eigenschaft von Cover-Bildern neben ihrem Informationsgehalt ist es nämlich, bestimmte Emotionen hervorzurufen. Und die müssen nicht zwingend positiv sein. Cover-Seiten dürfen ebenso provozieren, Meinungen vertreten oder Fragen aufwerfen – was es aussagen soll, kommt ganz auf den Inhalt Ihres Magazins und die Werte, die Sie damit nach außen tragen wollen, an. Wichtig ist auf jeden Fall, dass das Foto Druckqualität (300dpi) hat. Verpixelte Abbildungen, die eindeutig nicht so gewollt sind, machen keinen professionellen Eindruck.
Titelbilder müssen allerdings nicht zwingend ein Foto beinhalten. Gerne verwendet werden auch Illustrationen, um das Thema des Magazins widerzuspiegeln. Auch wenn diese Variante etwas zeitaufwendiger und kostspieliger ist, bietet sie Vorteile gegenüber der Fotografie. Einer davon ist, dass Illustrationen beliebig und nach den persönlichen Wünschen gestaltet werden können. Da sie zudem von keinen äußeren Gegebenheiten wie etwa Licht oder Location beeinflusst werden und daher leicht reproduzierbar sind, ist es einfacher, damit einen Wiedererkennungswert zu schaffen. Dieser ist wichtig, damit Leserinnen und Leser ein Magazin auf den ersten Blick erkennen.
Logo und Schriften
Damit dies gelingt, spielen jedoch besonders auch Titel oder Logo und die Schriften der Frontseite eine Rolle. Unternehmenslogos und Magazin-Titel müssen sich, wie das gesamte Cover, klar und deutlich von jenen ihrer Konkurrenz abheben. Niemand möchte, dass das eigene Magazin aufgrund grafischer Überschneidungen mit einem anderen Heft verwechselt wird. Das Programm Adobe Illustrator eignet sich gut dafür, einzigartige Logos zu entwerfen. Wie Sie hier vorgehen, wird in unserem Blogbeitrag „How to: Firmenlogos mit Adobe Illustrator gestalten“ erklärt. Idealerweise wird der fertige Titel oben mittig oder linksbündig auf dem Cover platziert. Grund dafür ist, dass in Trafiken und Supermärkten Magazine aus platzgründen meist übereinander aufgereiht werden. Da so entweder der untere oder der rechte Bereich des Heftes verdeckt wird, bietet sich diese Position an.
Weniger Einzigartigkeit ist bei den verwendeten Fonts gefragt. Schnörkel und Serifen sind auf einem Cover zwar nicht fehl am Platz, sollten aber der Leserlichkeit nicht im Weg stehen. Klassische Schriften eigenen sich gut für kurze und präzise (max. 10 Wörter) Artikel-Teaser. Das Hauptthema der Ausgabe können Sie jedoch durch eine Schriftart hervorheben, die sich von den anderen unterscheidet und zum Thema passt. Hier kann neben etwas außergewöhnlicheren Schriftarten auch mit Größe und Farbe variiert werden, um die Cover Story noch stärker in den Mittelpunkt zu rücken.
TIPP
Um Ihr Cover harmonisch und in einem optimalen Verhältnis der darauf abgebildeten Elemente zueinander zu gestalten, beachten Sie den Goldenen Schnitt. Diese Gewichtung betrifft Foto, Titel, Artikel-Teaser und alle restlichen Informationen, die auf Ihrem Cover zu finden sind. Dabei werden alle Elemente proportional aneinander angepasst. Ist also das Foto groß und dominant, sollte auch der Titel groß genug gewählt werden, um nicht unterzugehen. Sich absichtlich gegen den Goldenen Schnitt zu entscheiden, kann jedoch auch als Stilelement gewählt werden.
Bildquelle: unsplash.com
Das Podcast-Cover ist entscheidend, um neue Hörerinnen und Hörer zu gewinnen. Bei der Gestaltung sind einige wichtige Aspekte zu beachten. Wir zeigen Ihnen, mit welchen Tipps Sie Ihr Cover ansprechend gestalten und stellen Ihnen hilfreiche Tools und Designprogramme vor.
Das Podcast-Angebot wächst stetig, der Wettbewerbsdruck ist daher hoch. Um sich dennoch von der Konkurrenz abzuheben, optimieren Sie den ersten Eindruck der Hörerinnen und Hörer: das Titelbild. Es muss anziehend, klar und ausdrucksstark sein, gleichzeitig soll es Ihr Thema visualisieren. Dieser Blogpost unterstützt Sie bei Ihrem individuellen und zielgruppengerechten Erstellprozess.
Coverbild: Branding, Thema, Auftritt
Bevor Sie mit der Gestaltung des Podcast-Covers beginnen, definieren Sie zuerst Ihre Inhalte sowie Ihre potenzielle Zielgruppe, denn hier liegt der Schlüssel zum Erfolg. Kein Podcast funktioniert langfristig ohne Hörerinnen und Hörer. Daher gilt es herauszufinden, wer diese Personen sind und in weiterer Folge, wie Sie sie erreichen und ansprechen können. Das Podcast-Cover ist der erste Touchpoint für Ihre Kundinnen und Kunden und somit Ihr erstes und eines der wichtigsten Sprachrohre zur Außenwelt. Gefällt es, wird eher daraufgeklickt. Aus diesem Grund empfiehlt es sich, beim Design Zeit und Geld zu investieren. Es ist wichtig, einen visuellen Wiedererkennungswert zu schaffen und sich vorab Gedanken über Message und Branding des Podcasts zu machen. Um ein konsistentes und stimmiges Erscheinen Ihres Podcasts zu gewährleisten, müssen diese Aspekte im weiteren Verlauf bei der Cover-Erstellung aufgegriffen werden.
Leitfragen für das Cover-Design:
- Was ist das Thema des Podcasts? Wer oder was steht im Fokus?
- Wie soll das Thema Ihrer Zielgruppe vermittelt werden? Was ist Ihre Message?
- In welcher Form möchten Sie sich als Host in Ihrem Podcast widerspiegeln?
- Welche stilistischen Elemente (Schrift, Icons, Fotos, Farben) passen dazu?
- In welchem Ton sprechen Sie zu Ihren Hörerinnen und Hörer?
Welche Informationen braucht das Cover?
Das Motto bei der Titelbild-Gestaltung lautet: „Weniger ist mehr“. Daher konzentrieren Sie sich auf die wesentlichsten Elemente und überladen Sie Ihr Cover nicht mit Text, unzähligen Grafiken oder Farben. Beschränken Sie sich auf maximal sieben Wörter. Achten Sie außerdem darauf, dass Ihre zuvor ausgearbeitete Markenidentität in Bild- und Designsprache gleichbleibend ist sowie in allen Bereichen (Ansprache, Farben, Wording) in Verbindung zu Ihrer Message steht (=Corporate Design). Auf ein gelungenes Cover gehören daher:
- Symbolische Elemente: Denken Sie darüber nach, welche symbolischen Elemente Ihre Botschaft beziehungsweise Ihre Thematik stützen und visualisieren könnten. Behandeln Sie beispielsweise Rechtsthemen in Ihrem Podcast, wäre das Paragraphenzeichen ein passendes Sinnbild. Dieses Vorgehen ermöglicht Ihren Hörerinnen und Hörern eine rasche Zuordnung und kann deren Interesse wecken. Achten Sie auch darauf, welcher Ton in Ihrem Podcast herrscht. Treten Sie als Expertin oder Experte rein sachlich auf und widmen sich ausschließlich der Wissensvermittlung? Bauen Sie auch Privates und Humorvolles in Ihre Podcast-Folgen ein und nehmen dadurch eher eine freundschaftliche Ebene ein? Diese Punkte können etwa bei der Farbgestaltung oder dem Einsatz von Schriftarten berücksichtigt werden.
- Logo des Unternehmens: Wenn es sich bei Ihrem Podcast um ein unternehmensorientiertes Projekt handelt, platzieren Sie Ihr Logo am Cover. Das ermöglicht einen schnellen Wiedererkennungseffekt und vermittelt direkt die mit Ihrer Marke verbundenen Botschaften, wie zum Beispiel ein Qualitätsversprechen oder eine bestimmte Überzeugung.
Welches Design passt zu meinem Podcast?
Bei der visuellen Umsetzung des Podcast-Covers gibt es einige wichtige Dinge zu beachten:
- Schrift: Verwenden Sie eine angemessene Schriftgröße, damit Ihr Titel gut lesbar ist und mischen Sie maximal zwei unterschiedliche Schriftarten. Schriften ohne Serifen sind auf dem Display immer leichter zu lesen.
- Platzierung: Platzieren Sie relevante Elemente, wenn möglich nicht im unteren Drittel des Bildes, da bei einigen Podcast-Portalen das Abspielfunktions-Menü diesen Bereich verdeckt.
- Optimierung: Vergewissern Sie sich, wie Ihr Cover bei der Nutzung des Dark-Modus (einer dunklen Bildschirmdarstellung auf Smartphones mit schwarzem Hintergrund und weißer Schrift) wirkt. Verwendete Farben, Fotos und Bilder können in dieser Darstellungsoption eine ganz andere Wirkung erhalten. Ziel ist es, dass Ihr Titelbild in allen Formaten und Modi ansprechend ist.
- Konsistenz: Erarbeiten Sie ein einheitliches und konsistentes Corporate Design, um einen Wiedererkennungswert zu schaffen.
Ausschlaggebend für das Design des Covers ist auch, ob es sich bei Ihrem Podcast um einen persönlichkeitsorientierten (Personal Brand) oder unternehmensorientierte Podcast (Corporate Podcast) handelt:
- Personal Brand: Sie stehen als Host im Vordergrund Ihres Podcasts. Um daher eine Verbindung zu Ihren Hörerinnen und Hörern aufzubauen, empfiehlt es sich, Ihr Cover mit einem Foto von sich selbst zu versehen. Das schafft Vertrauen und wirkt zudem authentisch und seriös. Bilder lösen bei Menschen Gefühle und Emotionen aus und stellen etwas Reales dar. Dieser Wirkungsmechanismus („emotionale Werbung“) sollte beim Branding daher nicht außer Acht gelassen werden. Ein besonders bekanntes und erfolgreiches Beispiel für ein Personal Brand-Format ist der ZDF-Podcast „Lanz & Precht“, der Hörerinnen und Hörer persönlich zugetan mit gesellschaftlich und politisch relevanten Themen versorgt. Sowohl das Foto am Cover als auch der Name selbst (ebenso am Titelbild) lassen Rückschlüsse zum Qualitätsniveau des Podcasts zu. Beide Hosts, Markus Lanz und Richard David Precht, stehen für Qualitätsjournalismus und werden mit niveauvollen Beiträgen in Verbindung gebracht. Diese Assoziation wirkt sich unmittelbar vorteilhaft auf die Höreranzahl aus.
- Corporate Podcast: Im Falle von unternehmensorientierten Podcasts steht nicht nur eine bestimmte Person im Vordergrund, sondern eine bestehende Marke oder ein spezifisches Thema. Daher richten Sie das Cover passend zu Ihren Inhalten und der bestehenden Markenidentität aus. Das Einhalten der Markenrichtlinien (Farben, Schriftart etc.) schafft Wiedererkennungswert. Oft empfiehlt es sich in diesen Fällen auf Grafiken, Icons oder passende Symbole zurückzugreifen. Je nach Inhalt (zum Beispiel Nachrichtenpodcast) kann auch ein eher cleanes Titelbild mit klaren Strukturen von Vorteil sein. Als bekanntes Corporate-Beispiel können die Formate von Ö1 angeführt werden. Hier kommt am Cover immer wieder das gleiche Template zum Einsatz. Verwendete Farben lassen bereits erste Rückschlüsse zu den behandelten Themenbereichen (Nachrichten & Wissensvermittlung, Musik, etc.) zu, Kreise setzen klare Strukturen. Es herrscht am Bild wenig Ablenkung, man beschränkt sich bewusst auf die „cleane“ Gestaltung und rückt damit den Wiedererkennungswert der Marke und die individuellen Stärken in den Fokus. Handelt es sich um Formate, bei welchen bestimmte Personen im Vordergrund stehen wie zum Beispiel „Warum Klassik?“ befindet sich zusätzlich ein Porträt des Hosts am Titelbild. Dieses Vorgehen verdeutlicht das individuelle und notwendige Abwägen: Steht Ihr Unternehmen im Fokus oder ein Individuum, eine Person?
Welche technischen Voraussetzungen müssen Sie beachten?
Podcasts werden hauptsächlich am Smartphone oder auf mobilen Endgeräten konsumiert. Daher ist bei der Cover-Erstellung besonders darauf zu achten, dass alle Inhalte auch für kleinere Display-Darstellungen und die gängigen Abspielplattformen (Apple Podcasts, Spotify, etc.) optimiert werden. Diese technischen Aspekte müssen Sie dabei beachten:
- Für Podcast-Plattformen: quadratisches Format, minimal: 1400 x 1400, maximal: 3000 x 3000 Pixel
- Für die Verwendung des Covers auf Ihren sozialen Medien: 1080 x1920 Pixel
- Auflösung: 72 dpi
- Dateigröße: max. 515 kB
- Dateiformat: .jpeg oder .png
- RGB Farbraum, nicht CYMK
Woher bekomme ich Bilder und Grafiken?
Sowohl kostenpflichtige als auch Gratis-Websites bieten eine große Auswahl an hochwertigen Stockfotos. Achten Sie darauf, dass Sie ausschließlich hochauflösende Bilder verwenden, um einer verpixelten Ansicht entgegenzuwirken. Wichtig ist auch, dass Sie über die jeweiligen Lizenzen verfügen. Beispiele für Bilddatenbanken sind:
- Pexels
- Unsplash
- Freepik
- Adobe Stock (kostenpflichtig)
- Shutterstock (kostenpflichtig)
Welche Programme eignen sich?
Mit professionellen Bildbearbeitungsprogrammen wie Shutterstock oder Affinity Photo können Sie ganz individuell Ihr einzigartiges Podcast-Cover gestalten. Ihrer Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt. Allerdings bedürfen beide Programme einiger Vorkenntnisse und sind kostenpflichtig.
Einfacher ist es, auf bereits bestehende Vorlagen zurückzugreifen. Hierbei eignen sich besonders die beiden Programme Canva (kostenlos mit der Option eines preisgünstigen Upgrades in die Premium-Version) und Adobe Creative Cloud Express (kostenlose Testversion für 60 Tage, danach kostenpflichtig). Dort finden Sie unzählige Templates und Entwürfe, die Sie an Ihre Bedürfnisse anpassen können. Außerdem stehen Ihnen praktische Tools wie Farbpaletten, die bei der grafischen Feinabstimmung hilfreich sind, zur Verfügung. Die Farbauswahl ist besonders wichtig bei der Gestaltung, da sie einen großen Einfluss auf die Kundinnen- und Kundenwahrnehmung hat – Stichwort: Farbenlehre. Farben haben psychologische Effekte und wirken in verschiedenen Kontexten immer wieder anders auf Menschen. Daher spielen sie auch eine entscheidende Rolle im Marketing.
TIPP
Holen Sie von unterschiedlichsten Seiten Feedback zu Ihren Entwürfen ein! Fragen Sie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder auch Freundinnen und Freunde nach Ihrer Meinung und leiten Sie aus Ihrer Zielgruppe Personas ab, die Sie in Ihrer Umfrage einschließen. Dies sichert Ihnen eine direkte Rückmeldung zur Wirkung des Covers, zeigt Missverständnisse auf und ermöglicht eine zielgruppengerechte Optimierung.
Bildquelle: unsplash.com
Wer „Cookies“ hört, denkt erstmal an duftende Backwaren frisch aus dem großmütterlichen Ofen. Bei den Keksen im Internet sind Schokolade und Nüsse allerdings Fehlanzeige. Stattdessen handelt es sich bei den beliebten „Third Party Cookies“ um Funktionen, die Drittanbietern Aufschluss zum Userverhalten geben. Derzeit wird jedoch das sogenannte „Ende der Cookie-Ära“ prophezeit und wirft die Frage auf, wie Marketing ohne Third-Party Cookies aussehen wird.
Beginnen wir doch am Anfang. Kurz und knackig handelt es sich bei Cookies um einen Datensatz, der verwendet wird, um Userinnen und User einer Website zu identifizieren. Es wird generell zwischen First-Party Cookies, die von der besuchten Webseite selbst verwaltet werden, und Third-Party Cookies unterschieden. First-Party Cookies können in zwei Kategorien unterschieden werden: Notwendige Cookies sind essenziell, um die grundlegende Funktionstüchtigkeit einer Website zu gewährleisten. Sie sorgen beispielsweise dafür, dass die Daten im Warenkorb nicht verloren gehen oder Einstellungen der Sprache gespeichert werden. Funktionale Cookies erhöhen im Gegensatz dazu die Usability für die Nutzerin und den Nutzer, indem sie beispielsweise über mehrere Besuche hinweg auf der Seite eingeloggt bleiben.
Bei Third Party Cookies, auf Deutsch „Drittanbietercookies“, ist das Prinzip dasselbe. Auf dem Rechner wird gespeichert, wer eine bestimmte Website besucht hat. Als Unterschied zu den regulären Cookies werden diese aber nicht vom Website-Eigentümer gesetzt, sondern von Drittanbietern. Zu kompliziert?
Keine Sorge, rollen wir das Feld von ganz hinten auf: Eine Websitebetreiberin oder ein Websitebetreiber hat beispielsweise die Möglichkeit, Teile seiner Webpräsenz als Werbefläche zu verkaufen. Großteils kaufen diese Werbeplätze sogenannte Netzwerke, die die Anzeigen individuell und personenbezogen auf Seiten platzieren können. Für Endnutzerinnen und Endnutzer heißt das also konkret: Wenn sich jemand ganz besonders für Fotografie interessiert und einschlägige Websites dazu besucht, dann kann das Werbenetzwerk dieser Person genau auf sie zugeschnittene Werbung beispielsweise für Kamerazubehör ausspielen. Genau dafür wurden die Drittanbieter-Cookies bisher benötigt – das Verhalten der Personen im Netz verrät nämlich viel über deren Interessen und Konsumverhalten.
Welche Daten sammeln Third-Party-Cookies?
Third-Party-Cookies erlauben über die Identifikation einer Nutzerin oder eines Nutzers beispielsweise folgende Informationen zu ermitteln:
- Demographische Daten wie zum Beispiel das Alter, das Geschlecht oder den Standort
- Besuchte Webseiten und Unterseiten…
- …woraus zudem auch Interessensprofile gebildet werden können.
Die Kontroversen rund um Third-Party-Cookies würden darauf schließen lassen, dass die Userin oder der User aus dieser Methode des sogenannten „Nutzertargetings“ nur Nachteile zieht. So einfach ist das allerdings nicht. Denn obwohl Cookies datenschutzrechtlich umstritten sind, profitiert die Nutzerin oder der Nutzer auch von den Vorteilen maßgeschneiderter Werbung. Sind wir doch ehrlich: Wer hat noch nie etwas gekauft, weil dafür Werbung auf den sozialen Medien gemacht wurde? Viele Webinhalte werden zudem nur durch Werbung ermöglicht. Ein gänzliches Blockieren von Werbeanzeigen ist der Vielfalt des Internets daher nicht zuträglich.
Gleichzeitig können Webseitenbetreiber Werbeplätze wesentlich teurer verkaufen, wenn die Werbung zielgerichtet ausgesteuert werden kann. Das stellt die Überlebensfähigkeit zahlreicher Web-Publikationen sicher, die nicht genug Reichweite hätten, um bei billigeren Werbepreisen überlebensfähig zu bleiben.
Natürlich sollte man dennoch wachsam bleiben, was die Nutzung von Third-Party-Cookies betrifft und sie gegebenenfalls einschränken oder gar verhindern. Es ist ein fließender Übergang von der Bildung von Interessensprofilen über alltägliches Kaufverhalten bis hin zur Identifikation politischen Wahlverhaltens, der sexuellen Orientierung oder ähnlichen Punkten, die höchstpersönliche Lebensbereiche berühren.
Aus einem Urteil des EuGH im Oktober 2019 ging hervor, dass voreingestellte Zustimmungsbanner, die automatisch ihre Einwilligung für die Nutzung von Cookies geben, unzulässig sind. Userinnen und User müssen also Cookies aktiv und freiwillig zustimmen, bevor diese für Werbezwecke verwendet werden dürfen.
Welche Alternativen gibt es für eine cookielose Zukunft?
Nachdem immer mehr Userinnen und User Third-Party-Cookies aus den genannten Gründen blockieren, haben sich Unternehmen rund um die meistgenutzten Browser nun dazu entschlossen, diese endgültig zu verbannen. Grundsätzlich kündigte Google bereits Anfang 2020 an, Third-Party-Cookies im Google-Browser Chrome abzuschaffen. Der „Cookiegeddon“ wurde für 2022 angedacht, inzwischen aber bereits auf 2023 verschoben. Google meinte dazu im März 2021:
„Heute machen wir deutlich, dass wir nach dem Auslaufen von Cookies von Drittanbietern keine alternativen Kennungen erstellen werden, um Einzelpersonen beim Surfen im Internet zu verfolgen, und wir werden sie auch nicht in unseren Produkten verwenden.“
Werbetreibende fordern daher neue Lösungswege, wie das Nutzerverhalten messbar gemacht werden kann. Dazu möchten wir euch dreieinhalb mögliche Wege aufzeigen:
- Contextual Targeting: Dabei handelt es sich um eine programmatische Targeting-Lösung. Der Content einer Website wird von Anbietern der Werbeflächen gescannt. Dabei geht es sowohl um technische als auch linguistische Aspekte. Kommt etwa auf der Seite ein bestimmtes Wort vor, kann entsprechend Werbung dort platziert werden. Aufgrund dieser Kontext- und Schlagwortanalyse wird Werbung – ohne Nutzerverhalten auszuwerten – in dem richtigen Umfeld ausgespielt. Allerdings ist hier die Relevanz der Nutzerinnen und Nutzer unvergleichlich schlechter als bei tatsächlich individualisierten Nutzerprofilen und die erwartbaren Werbeumsätze entsprechend geringer.
- Identifier: Bei der ID-Lösung werden anonyme Identifier erstellt. Wenn sich eine Userin oder ein User mit seiner E-Mail-Adresse auf einer Website anmeldet, wird für sie oder ihn ein Identifikations-Code vergeben. Im Internet wird diese Nutzerin oder dieser Nutzer nun anhand der vergebenen ID erkannt und kann so für das Retargeting, also das zielgerichtete Bespielen mit Werbeinhalten auch auf anderen Webseiten, genutzt werden. Die Daten sind datenschutzkonform und verschlüsselt, und können sowohl offline als auch online miteinander verknüpft werden.
- Facebook-Pixel-Lösung: Facebook ist bisher die einzige Plattform, die bereits eine Lösung aufbereitet hat. Für uns ist sie allerdings nur eine halbe Lösung, denn es ändert sich technisch nicht viel. Der Facebook-Pixel wird einfach als First-Party-Cookie deklariert. Das bedeutet, dass der Cookie dann für den Browser so aussieht, als würde er zu der Website gehören, auf der die Userin oder der User surft. Um DSGVO-konform zu agieren, braucht es dafür allerdings auch eine Einwilligung (Opt-In) vonseiten der Userin oder des Users, dass Daten getrackt werden dürfen.
- Topics API: Die neusten Cookie-Lösung von Google stammt von Ende Jänner 2022. Dabei handelt es sich um Topics API. Topics ist ein neuer Datenschutz-Sandbox-Vorschlag für interessensbasierte Werbung. Der Browser erstellt wöchentlich für jede Nutzerin und jeden Nutzer Themenprofile wie „Fitness“ oder „Reisen“, die für diese Woche aufgrund ihres Browserverlaufs relevant sind. Beim Besuch einer Website wählt Topics drei Themen aus – ein Thema aus jeder der letzten drei Wochen, um sie mit der Website und ihren Werbepartnern zu teilen.
Einige Optionen stehen somit schon in den Startlöchern, die Third-Party Cookies nach ihrem Aus 2023 ersetzen werden. Ähnlich wie die sich ändernden Bedingungen, die früher zu Cookie-basierter Werbung geführt haben, werden also auch hier Lösungen gefunden werden, wie Marketing in einer neuen Ära zielgerichtet funktionieren kann.
Bildquelle: Dusan Petkovic – Adobe Stock
Marke und Design stehen für Qualität und Herkunft eines Produkts. Als Marketing Tools sind sie unerlässlich, um sich von der Konkurrenz abzugrenzen und den Wiedererkennungswert zu erhöhen. Wir erklären Ihnen, wie Sie sich wirksam gegen unerlaubte Nachahmungen Ihrer Marke oder Ihres Designs wehren können.
Marken kennzeichnen Waren oder Dienstleistungen, um diese voneinander unterscheidbar zu machen und einem Unternehmen zuzuordnen. Sie können zum Beispiel auf Waren oder Verpackungen angebracht oder in der Werbung genutzt werden. Die gängigsten Markenformen sind etwa Wortmarken die aus Buchstaben, Zahlen und Sonderzeichen bestehen (z.B. „NESTLE“) oder Wortbildmarken, die Elemente einer Wortmarke mit einer grafischen Darstellung verbinden (z.B. VW-Emblem). Eine Marke kann weiters aus Personennamen, rein grafischen Elementen, Farben (z.B. Manner-Rosa), einer dreidimensionalen Form oder aus Klängen bestehen.
Das Aussehen eines Produkts, also das Design, wird rechtlich „Muster“ genannt. Dazu gehören alle visuell wahrnehmbaren Merkmale (Farbe, Form, Oberflächenstruktur, Werkstoff, etc.). Die Idee oder Erfindung hinter dem Produkt wird dabei nicht geschützt – es geht allein um das Aussehen. Geschützt ist also zum Beispiel das Layout eines Computerprogrammes, aber nicht das Computerprogramm selbst.
Schutz in Österreich, in der EU oder weltweit?
Soll ein Produkt auch über die österreichischen Grenzen hinweg vermarktet werden, könnte es Sinn machen, eine Marke oder ein Design in der gesamten EU oder weltweit zu schützen.
Für einen EU-weiten Schutz müssen Marken und Designs beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) angemeldet werden. Auf der Website können die jeweiligen Gebühren online berechnet werden: Die Kosten für eine Unionsmarke – also mit Schutz in sämtlichen EU-Mitgliedsstaaten – beginnen bei 850 Euro. Das sogenannte EU-Gemeinschaftsgeschmacksmuster, also der europäische Schutz eines Designs, startet bei 350 Euro. Nach der Registrierung ist eine Unionsmarke zehn Jahre, ein EU-weiter Designschutz zwischen drei und fünf Jahre gültig. Außerdem kann bei der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) eine internationale Marke oder ein internationales Design angemeldet werden.
Für einen österreichweiten Schutz kann die Anmeldung online über die Website des Patentamts und bei Marken sogar über ein Schnellverfahren innerhalb von 10 Tagen durchgeführt werden. Ein Patent- bzw. Rechtsanwalt ist dafür nicht zwingend erforderlich. Bei erfolgreicher Anmeldung wird die Marke im Markenregister und das Design im Musterregister registriert. Erst nach der Registrierung darf der Marke das Symbol für registrierte Marken ® (R im Kreis) angefügt werden.
Nutzungsrecht für Marken und Designs in Österreich
Wird eine Marke im Markenregister eingetragen, ist sie zehn Jahre lang geschützt. Das kostet ab 284 Euro. Inhaberinnen oder Inhaber einer Marke können in dieser Zeit anderen verbieten, ein für gleiche Waren oder Dienstleistungen gleiches Zeichen wie ihre Marke zu nutzen. Andere dürfen ohne ihre Zustimmung auch nicht gleiche oder ähnliche Zeichen für gleiche oder ähnliche Produkte einsetzen, wenn dadurch eine Verwechslungsgefahr mit ihrer Marke besteht. Dieser Schutz kann alle zehn Jahre durch Zahlung einer Gebühr erneuert werden.
Die Registrierung eines Designs im Musterregister sichert das ausschließliche Nutzungsrecht an einem Design zu – für erneuerbare fünf Jahre und das ab 82 Euro. Der Schutz umfasst insbesondere die Herstellung, das Anbieten, die Einfuhr, die Ausfuhr oder die Benutzung eines Erzeugnisses, in das das Design aufgenommen oder bei dem es verwendet wird.
Werden registrierte Marken oder Designs verletzt, haben die Betroffenen verschiedene zivilrechtliche Ansprüche, zum Beispiel auf Unterlassung, Beseitigung oder Schadenersatz. Es gibt auch strafrechtliche Folgen: Wer eine Marke im geschäftlichen Verkehr oder generell ein Design verletzt, dem droht eine Geldstrafe – bei gewerbsmäßiger Begehung sogar eine Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren.
Voraussetzungen für die Registrierung
Für die Registrierung müssen Marken unter anderen unverwechselbar sein und dürfen inhaltlich weder ausschließlich das Produkt bezeichnen („Apfel“) noch einen Hinweis auf die Eigenschaften („steirischer Apfel“) liefern. Marken müssen nicht neu sein, sie dürfen also schon vor der Anmeldung verwendet worden sein.
Das ist beim Design anders. Dieses muss sich nicht nur von anderen Designs unterscheiden, sondern hat insbesondere neu zu sein: Es darf zuvor kein identisches Design veröffentlicht worden sein. Das Design sollte also angemeldet werden, bevor es öffentlich vorgestellt oder verwendet wird. Ausnahmsweise kann es trotzdem geschützt werden, wenn es erst im Jahr vor der Anmeldung veröffentlicht wurde.
Bei der Anmeldung einer Marke muss diese einer bestimmten Waren- oder Dienstleistungsklasse zugeordnet werden, die in der sogenannten Nizza-Klassifikation zu finden sind. Auch Designs werden immer für bestimmte Waren angemeldet, für diese gilt die Locarno-Klassifikation. Die jeweiligen Klassifikationen werden in Infoblättern des Patentamts im Detail aufgezählt und erklärt.
To Do: Recherche, Recherche, Recherche
Vor der Anmeldung sollte eine ausführliche Recherche durchgeführt werden, um sich einen Überblick über bereits registrierte Marken und Designs zu schaffen. Das Europäische Patentamt zum Beispiel bietet ein kostenloses Online-Tool zur Marken- und Designrecherche sowie zur Durchsuchung der jeweiligen Klassifikationen an.
Eine erfolgreiche Registrierung bedeutet nämlich nicht, dass eine Marke oder ein Design nicht vorzeitig gelöscht wird. Zum Beispiel können Inhaberinnen und Inhaber älterer Marken in Form eines Widerspruchs die rückwirkende Aufhebung der Registrierung verlangen, wenn eine Verwechslungsgefahr mit ihren bereits früher angemeldeten oder registrierten Marken besteht. Das Patentamt überprüft die Anmeldung eines Designs nur formell. Es wird also nicht gesondert kontrolliert, ob es zum Beispiel bereits vor der Anmeldung veröffentlicht wurde. Sollte dies der Fall sein und das Design daher keinen Neuwert haben, können Inhaberinnen und Inhaber älterer Designs verlangen, dass das jüngere Design aus dem Musterregister entfernt wird.
Tipp
Die Wirtschaftskammern in den Bundesländern bieten kostenlose Marken- und Patentsprechtage an. Zusätzlich gibt es Erstinformationen und Webinare beim Patentamt.
Bildquelle: pixabay.com
Das Erstellen einer Website wurde über die Jahre durch Homepage-Baukästen vereinfacht, um die Möglichkeiten für Progammier-Laien zu verbessern. Auch Web-Editoren finden aber immer noch Anwendung. Wir verraten Ihnen den Unterschied.
In unserer digitalisierten Welt kommen Unternehmen, aber auch Selbstständige nicht umhin, potenziellen Kundinnen und Kunden eine anschauliche Website zur Präsentation ihrer Waren und Dienstleistungen zu bieten. Sie dienen der Information, bevor eine endgültige Kaufentscheidung getroffen wird. Bleiben Unternehmen offline, sind sie für ihre Zielgruppe weitestgehend unsichtbar und scheinen daher im Entscheidungsprozess oft gar nicht erst auf. Ein adäquater Internetauftritt sollte daher nie unterschätzt werden. Für viele Gewerbetreibende, vor allem solche, die keine hauseigene IT-Abteilung besitzen, übersteigt die Erstellung einer eigenen Firmenwebsite aber häufig das Budget. Abhilfe schaffen sogenannte Web-Editoren und Homepage-Baukästen, die je nach Computerkenntnissen einen kostengünstigen Online-Internetauftritt „zum Selberbauen“ zur Verfügung stellen. Wir verraten Ihnen welche Vor- und Nachteile die beiden Lösungen bieten.
Einfache Bedienung mit Homepage-Baukästen
Der größte Vorteil an Baukasten-Systemen ist, dass Nutzerinnen und Nutzer weder Kenntnisse der gängigen Programmiersprachen wie HTML, CSS oder JavaScript benötigen noch generell technisch besonders versiert sein müssen. Die Anbieter sind meist kostengünstig oder überhaupt gratis und bieten Nutzerinnen und Nutzern intuitive Bearbeitungsoberflächen. Dabei unterscheiden sich Online-Baukästen, die direkt im Internet erstellt werden, und Offline-Baukästen, für die Sie eine Software auf ihrem Computer installieren müssen. Der Trend geht auf jeden Fall zur internetbasierten Variante.
Bei allen gilt jedoch: Auf einer zunächst leeren Seite wird anfangs ein Layout samt passendem Farbschema ausgewählt und darauf per Drag-and-Drop die gewünschten Elemente wie beispielsweise verschiedene Textkästen oder Foto-Slider platziert. Manche der Website-Anbieter wie das bekannte deutsche Unternehmen Jimdo stellen sogar eine Datenbank mit lizenzfreien Fotos zur freien Verwendung zur Verfügung, alternativ können aber auch Fotos von Sozialen Medien wie Instagram oder Facebook importiert werden. Bei dem ebenfalls weit verbreiteten israelischen Dienstleister Wix werden zudem Tools für die SEO-Optimierung aber auch die Möglichkeit, eigene Codezeilen in den Quellcode der erstellten Website zu ergänzen, angeboten. Dafür ist jedoch ein gewisses Know-How in dem Bereich von Nöten. Im Gegensatz dazu können Unternehmerinnen und Unternehmer, die sehr eingeschränkte Computerkenntnisse haben, oder aus einem anderen Grund auf das Selberbauen verzichten wollen, das Content-Management-System Wix ADI (Artificial Design Intelligence) verwenden, das anhand einiger Fragen selbstständig eine Website für sie designt. Bei diesem Anbieter können, wie auch bei einigen anderen der Homepage-Baukästen, über einen App-Store zusätzliche Funktionen, sogenannte Widgets, installiert werden. Das ist beispielsweise auch bei den Content-Management-Systemen (CMS) WordPress und Joomla der Fall. Anders als die klassischen Homepage-Baukästen sind sie flexibler verwendbar, aber auch durch den Einsatz von zahlreichen Plugins für jede einzelne Funktion deutlich komplexer und technisch anspruchsvoller. Gerade durch ihre äußerst weite Verbreitung sind sie außerdem auch ein beliebtes Ziel für Angreiferinnen und Angreifer.
Nach einem Test des deutschen Technikmagazins Chip schneiden unter den 13 gängigsten Homepage-Baukästen im Gesamten die etwas weniger bekannten Anbieter Cabanova und Strato aufgrund ihrer Anwenderfreundlichkeit und Gestaltungsfreiheit am besten, der Anbieter Homepage-Baukasten am schlechtesten ab. Egal in welcher Form oder bei welchem Anbieter Sie jedoch Ihre Website erstellen, sollte Ihnen bei der Verwendung einer dieser Lösungen bewusst sein, dass die Umsetzung von besonders komplexen Unternehmensseiten nach sehr persönlichen Vorstellungen eher nicht möglich ist. Auch sind Sie meist an Ihre gewählte Anbieterin oder Ihren gewählten Anbieter gebunden und können ihre Website nur schwer oder gar nicht mitnehmen, wenn Sie wechseln wollen. Achten Sie also vor Ihrer Entscheidung darauf, ob das Baukasten-System Ihren Vorstellungen entspricht, der Preis angemessen ist und die Kündigungsfrist in einem akzeptablen Zeitraum liegt. Auch die Erstellung einer Website mit solchen Drag-and-Drop-Lösungen benötigt einiges an Zeit und Mühe.
Mehr Freiheiten mit Web-Editoren
Wollen Sie lieber unabhängig bleiben und ihre Website lokal auf Ihrem Rechner erstellen, bieten sich stattdessen Web-Editoren an. Sie sind eine praktikable Lösung für statische Websites, also solche, die sich mit der Zeit kaum verändern müssen. Allerdings sind sie nicht ganz so einfach gestrickt wie Homepage-Baukästen – besonders, da Sie dafür zumindest Grundkenntnisse im Programmieren benötigen. Web- oder HTML-Editoren sind daher eher für Webdeveloper geeignete Tools, die weniger intuitiv funktionieren.
Unterschieden wird hier zwischen textbasierten Programmen, bei denen direkt im Quelltext Änderungen vorgenommen werden, und sogenannten „What you see is what you get“ (WYSIWYG)-Editoren. Erstere bieten im Gegensatz zu normalen Texteditoren verschiedene hilfreiche Möglichkeiten, etwa im Quellcode einer Website gewisse Befehle farblich hervorzuheben, eine automatische Code-Vervollständigung oder eine Suchen-und-Ersetzen-Funktion. WYSIWYG-Editoren zeigen bereits bei der Bearbeitung den Code als Echtzeit-Vorschau an – so wie er als Website später von Nutzerinnen und Nutzern im Internet gesehen wird. Gerade für weniger geübte Programmiererinnen und Programmierer ist diese Funktion hilfreich, um am Ende eine Website nach ihren Vorstellungen zu erhalten.
Stackoverflow.com, eine amerikanische Entwicklerplattform, befragte im vergangenen Jahr 2021 über 80.000 Webentwickler zu ihrem beliebtesten Programm. Den ersten Platz belegte dabei der Quelltext-Editor Visual Studio Code von Microsoft, da er nicht nur eine Vielzahl an Programmiersprachen unterstützt, sondern die Funktionen des kostenlosen Programms durch sogenannte Extensions erweitert werden können. Ein zahlungspflichtiges Pendant dazu ist beispielsweise Adobe Dreamweaver, ein HTML-Editor mit WYSIWYG-Vorschau. Wer auch sonst mit den Programmen der Creative Cloud desselben Anbieters arbeitet, kann hier ganz einfach Elemente aus den Bibliotheken und aus Adobe Stock in die Website einbinden. Beide dieser Programme benötigen eine Software, die auf den Computer heruntergeladen werden muss. Auch bei Web-Editoren gibt es jedoch Online-Versionen wie html-online.com. Für diese kostenlose Variante muss nichts heruntergeladen werden, dafür ist allerdings eine funktionierende Internetverbindung zwingend notwendig.
Wenngleich Web-Editoren immer mehr von den praktischen Homepage-Baukästen abgelöst werden, bleibt es natürlich Ihnen und Ihren Computer-Fähigkeiten überlassen, welches Programm Sie als Ihren Favoriten wählen.
Bildquelle: Zaripov Andrei – Adobe Stock
Sie suchen nach neuen Ideen für spannenden Content, doch Ihre Kreativität lässt Sie im Stich? Mit diesen vier Brainstorming-Methoden generieren Sie mehr Ideen allein oder im Team.
„Using the brain to storm a problem“ (wörtlich: das Gehirn verwenden, um ein Problem zu stürmen), das war der Leitsatz des amerikanischen Autors und Werbefachmannes Alex F. Osborn, als er 1939 eine neue Möglichkeit der Ideenfindung in einer Gruppe von Menschen geschaffen hat. Es war die Geburtsstunde des Wortes „Brainstorming“ und seither verwendet fast jeder diesen Begriff, um allein oder in der Gruppe nach Ideen zu suchen und Lösungsansätze zu schaffen. Damit das Brainstorming auch gelingt, gibt es aber einige Regeln und Methoden, die beachtet werden sollten. Welche das genau sind, sehen wir uns nun näher an. Noch kurz vorweg: In diesem Blogbeitrag liegt der Fokus auf Brainstorming im Content Marketing.
Brainstorming-Regeln
Nr. 1: Keine Kritik
Die Methode des Brainstormings diente anfänglich dazu bei Business Meetings gemeinsame Lösungsansätze und Ideen zu schaffen, ohne gleich mit Kritik überhäuft zu werden. Die Devise: „Jede Idee ist willkommen!“. Es gibt keinen Platz für Negativität und keine Idee ist besser als die andere. Egal ob allein oder im Team gebrainstormt wird, kein Vorschlag oder Lösungsansatz ist lächerlich oder unangebracht. Angst vor Kritik findet beim Brainstorming keinen Platz. Eine gute Atmosphäre ist Voraussetzung.
Nr. 2: Quantität vor Qualität
So komisch es auch klingen mag, am Anfang eines Brainstorming-Prozesses lautet das Motto: „Masse vor Klasse.“ Umso mehr Ideen, desto besser. Anstatt auf die große Idee zu warten, ist es empfehlenswert alle Ideen festzuhalten. Diese Methode gibt Ihnen eine große Vielfalt an Optionen und ermöglicht dem Team aus Inputs weitere Ideen zu spinnen. Nicht jede davon wird großartig sein, aber eine schlechte Idee kann manchmal im gemeinsamen Denkprozess zu mehreren guten Lösungsansätzen führen.
Nr. 3: Platz für ungewöhnliche Ideen
Laut Osborn ist es einfacher, eine wilde Idee zu zähmen, als eine neue zu erfinden. Viele ungewöhnliche Ideen sind häufig die Basis für große Erfolge. Es lohnt sich immer über den eigenen Tellerrand zu blicken. Zusätzlich unterstützen mutige Denkanstöße den Kreativitätsprozess und schaffen einzigartige Lösungsansätze.
Nr. 4: Querdenken
Gedankenstürme sind dazu da, um aus eingeworfenen Inputs weitere Ideen zu spinnen, frei zu assoziieren oder zu kombinieren. Lassen Sie Ihre Gedanken schweifen und denken Sie außerhalb der klassischen Schubladen. Ein Problem kann auch unkonventionell gelöst werden. Sie können zudem versuchen, Lösungen aus einem anderen Bereich auf die aktuelle Fragestellung zu übertragen. Das Rad muss nicht komplett neu erfunden werden. Durch ein paar Anpassungen und neue Gedankengänge nähern Sie sich immer mehr der besten Lösung.
Brainstorming-Methoden
Egal ob Sie allein oder im Team brainstormen, es ist wichtig Ihre Gedanken zu strukturieren. Die Visualisierung der Ideensammlungen ist fundamental, damit gute Geistesblitze nicht wieder in Vergessenheit geraten. Auch für die Nachbereitung des Brainstormings ist das Festhalten der Gedanken vorteilhaft. Für all diese Optionen bieten sich unterschiedliche Methoden an, die die Konzentration der Teilnehmerinnen und Teilnehmer fordern:
Nr. 1: Die klassische Mindmap
Eine Mindmap (englisch für Gedankenlandkarte beziehungsweise Gedächtnislandkarte) ist eine sehr gängige Form, um Notizen kreativer anzufertigen. Zusätzlich handelt es sich um eine Brainstorming-Methode, die hilft, Fakten zu strukturieren, Zusammenhänge zu entdecken und sich einen Themen-Überblick zu verschaffen. Sie können sich eine Mindmap wie einen durchgesägten Baumstamm vorstellen: In der Mitte steht das zentrale Thema und von dort aus gehen beliebig viele Äste ab, in denen die Unterpunkte ergänzt werden. Egal ob Sie nach kreativen Ideen für Ihre nächste Marketingkampagne suchen oder einfach Ihre Gedanken mit Kolleginnen und Kollegen austauschen wollen, Mindmaps sind ein idealer Ausgangspunkt. In vielen Fällen genügt nur ein weißes Blatt Papier oder ein Whiteboard. In der ersten Phase des Brainstormings wird empfohlen nur die eigenen Gedanken festzuhalten und auf Suchmaschinen oder andere Recherchemittel zu verzichten.
Tipp
Im Homeoffice sind Online-Mindmaps eine gute Lösung zum Austausch mit den Arbeitskolleginnen und Arbeitskollegen. Die kostenlosen Applikationen von Lucid Chart, Miro und Canva bieten sich dazu besonders gut an.
Nr. 2: Brainswarming
Zum klassischen Brainstorming haben sich mittlerweile zahlreiche Alternativen und Abwandlungen entwickelt. Der Amerikaner Tony McCaffrey entwickelte die Brainswarming-Methode, um auch den weniger extrovertierten Teammitgliedern die Chance zu bieten, sich durchzusetzen. Diese Brainstorming-Variante findet anfangs nicht mündlich statt. Alle Beteiligten schreiben Ihre Ideen auf Post-Its. Somit hat jeder Zeit, sich selbst Gedanken zum vorgegebenen Thema zu machen. In einem nächsten Schritt werden die einzelnen Notizen an eine gemeinsame Pinnwand geheftet, um die Ideen miteinander zu verbinden und gemeinsam an Lösungsvorschlägen zu arbeiten. Auch schüchterne Teilnehmerinnen und Teilnehmern bekommen somit die Möglichkeit ihre Ideen zu präsentieren. Zusätzlich ist nicht jeder gleich von den ersten Inputs beeinflusst und kann den eigenen Gedankengang zu Ende bringen.
Nr. 3: Methode 635
Bei dieser Methode schreiben sechs Teilnehmerinnen oder Teilnehmer drei Ideen auf ein Blatt. Anschließend werden die Ideenblätter insgesamt fünf Mal weitergegeben. So bekommt jede Teilnehmerin/ jeder Teilnehmer jedes einzelne Blatt ein Mal und ergänzt die vorhandenen Vorschläge mit Inputs.
Tipp
Diese Variante eignet sich auch sehr gut, um im Homeoffice an Ideen gemeinsam zu feilen. Es genügt einfach eine Word-Datei, die weitergesendet wird.
Nr. 4: Provokationstechnik
Wenn Sie die bisherigen Methoden noch nicht überzeugt haben, dann ist möglicherweise diese Variante der richtige Weg für Sie. Anhand von übertriebenen Fragestellungen, Provokationen und zugespitzten Aussagen wird die Kreativität der Beteiligten angeregt. Wenn sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eines Unternehmens zum Beispiel eine Vier-Tage-Woche wünschen, kann eine übertriebene Aussage lauten: „Diese Personen möchten eigentlich gar nicht arbeiten.“ Dieser provokante Satz weckt unterschiedliche Bilder in den Köpfen der Beteiligten. Hier ist vor allem wichtig, dass jeder Gedanke mit den übrigen Teilnehmerinnen und Teilnehmern geteilt und auf einem Whiteboard oder einem Blatt Papier festgehalten wird. Aus den unterschiedlichen Meinungen zu dieser Provokation kann ein Brainstorming entstehen, das durch Umdenken und Umformulierungen möglicherweise zu einem perfekten Marketingslogan für das Unternehmen führt.
Das gemeinsame Brainstorming
Eine entscheidende Rolle beim gemeinsamen Brainstorming spielt die Moderation. Sie hat die Aufgabe zu motivieren, stimulieren und strukturieren. Die Moderatorin/ der Moderator darf niemals das Ziel aus den Augen verlieren. Daher ist es empfehlenswert, dafür jemanden zu wählen, der mitdenkt, unparteiisch ist und zugleich in der Lage, den Überblick zu behalten. Die Moderation beinhaltet zusätzlich zur Festlegung der oben bereits erwähnten Regeln noch folgende Punkte:
- Planung und Vorbereitung des Brainstormings
- Ausformulierung der Agenda
- Strukturierung der Ideen
- Miteinbindung und Motivation aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer
- Dokumentation der Ergebnisse
Brainstorming allein
Natürlich lassen sich die unterschiedlichen Brainstorming-Methoden auch alleine anwenden. Hier finden Sie einige zusätzliche Tipps, die Ihrer Kreativität auf die Sprünge helfen und die Gehirnzellen ankurbeln:
1. Keine Ablenkung
Unterschiedliche Social-Media-Kanäle, E-Mails, Anrufe sowie Gespräche mit Kolleginnen und Kollegen unterbrechen die Konzentration. Vermeiden Sie daher in der Brainstorming-Phase Störfaktoren. Schalten Sie das Handy auf lautlos und geben Sie allen zu verstehen, dass Sie aktuell nicht erreichbar sind. Es sind die stillen Momente, in denen gute Ideen entstehen.
2. Tapetenwechsel
Durchgehend auf ein und dieselbe Wand zu schauen, inspiriert nicht. Nutzen Sie Pausen für Spaziergänge in der Natur. Diese Herangehensweise weckt den Erfindergeist.
3. Stift und Papier
Viele Stunden vor dem Computer nagen an der Kreativität. Schalten Sie während eines Brainstormings den Bildschirm aus und greifen Sie stattdessen zu Stift und Papier. Aus ungeordneten Gedankenschnipseln können viele großartige Ideen entstehen.
4. Keine Erwartungen
Ein Brainstorming ist kein fertiges Produkt. Es handelt sich hierbei um eine Grundidee, die mehrere Feinschliffe benötigt. Denken Sie immer daran, dass dies der erste schwerelose Schritt ist, der viel Platz für Kreativität beinhaltet.
5. Zeitlimits setzen
Ein wichtiger Punkt, um beim Brainstorming gute Erfolge zu erzielen sind Zeitlimits! In vielen Ratgebern wird die Dauer von 30 bis 45 Minuten empfohlen. Achten Sie auf die Zeit, da stundenlange Gedankengänge häufig ins Nichts führen. Brainstorming kann helfen, viele neue und innovative Ideen in kurzer Zeit anzuregen.
In vielen Fällen benötigt routiniertes Brainstorming kaum Vorbereitung. Auch die Durchführung ist einfach und unterstützt die Gruppendynamik. Nichtsdestotrotz gibt es einige Punkte zu beachten, um ein optimales Setting zu erzeugen. Schon Victor Hugo, französischer Schriftsteller und Politiker, unterstrich die Macht der Gedanken, indem er betonte: „Nichts auf der Welt ist so mächtig wie eine Idee, deren Zeit gekommen ist.“
Bildquelle: Flamingo Images – stock.adobe.com
Ein Sprichwort besagt „Totgesagte leben länger.“ Wenngleich bereits seit mehreren Jahren über das Sterben der Printmedien debattiert wird, sind Unternehmen dennoch gut beraten, Printprodukte nicht als Relikte vergangener Zeiten, sondern essenzielle Elemente erfolgreicher 360°-Strategien zu sehen. Wer die volle Bandbreite des Content Marketing für sein Unternehmen nutzen möchte, sollte nicht auf gedruckte Inhalte verzichten: ob nun als Kunden- oder Mitarbeitermagazin, Argumente dafür gibt es viele.
Auch wenn sie ihre ehemalige Monopolstellung mittlerweile verloren haben, bilden vor allem Kundenmagazine einen essenziellen Teil erfolgreicher Content Strategien. Neben Websites, Podcasts und Social-Media-Kanälen bleiben Magazine – vor allem in Österreich – gern gelesene Medienprodukte. Laut den Zahlen der ÖAK (Österreichische Auflagenkontrolle) -Analyse 2021, ist die Druckauflage von monatlich erscheinenden Kundenmagazinen, mehr als fünfmal so hoch, wie jene von Kaufperiodika. Zum Vergleich: auto touring, das erfolgreichste heimische Mitgliedermagazin, herausgegeben vom Verkehrsclub ÖAMTC, hatte 2022 laut ÖAK eine Auflage von über 1,8 Millionen Exemplaren. Und die hält sich seit den letzten Jahren konstant bzw. konnte seit 2013 sogar um mehr als 200.000 Ausgaben gesteigert werden. Ebenfalls sehr auflagenstark: die Lifestylemagazine active beauty und maxima der Drogerieketten dm und BIPA. Auch das zweiterfolgreichste heimische Gratis-Monatsmagazin Kärnten.magazin, konnte seine Auflage heuer bereits um fast 5.000 Exemplare zum Vorjahr auf 299.357 steigern.
Während redaktionelle Magazine von Abonnements oder dem Einzelverkauf abhängig sind, erreichen Sie mithilfe von Corporate Publikationen wie Unternehmens-, Kunden- oder Mitarbeitermagazinen Ihre Zielgruppe viel direkter und zielgerichteter. Dennoch gilt es sich in ihrer Gestaltung an redaktionellen Produkten, eventuell durch weniger werblichen, sondern eher service-orientierten Elementen zu orientieren.
Print ist greifbar
Newsletter, Onlineanzeigen oder Infobanner – während die wenigsten Userinnen und User Onlinewerbung aufmerksam konsumieren, gehen Printprodukte im digitalen Chaos nicht unter. Sie setzen da an, wo Digital-Only-Strategien an ihre Grenzen stoßen. Durch ihre haptische Eigenschaft sprechen sie mehr Sinne an als rein digitale Formate und sind dadurch anders und nachhaltig erlebbar. Auch werden sie zumeist in entschleunigterem Ambiente konsumiert, im Gegensatz zum digitalen Raum gibt es hier weniger Ablenkung, was sich in Wirkung- und Nutzungsdauer widerspiegelt. Ansprechendes Design und hochwertiges Papier zeigen den Kunden außerdem, welche Qualitätsstandards Ihr Unternehmen hat. Kundenmagazine können nicht einfach „weggeklickt“ oder aus dem Posteingang gelöscht werden – der Eindruck, den sie hinterlassen können, ist definitiv von längerer Dauer.
Print ist glaubwürdig
Zahlreiche Studien setzen sich mit der Glaubwürdigkeit von medialen Formaten auseinander. Der Konsens lautet, dass über alle Generationen hinweg Print immer noch als zuverlässigste Quelle angesehen wird, während Inhalte auf Social Media eher auf Skepsis treffen. Eine vornehmlich auf Journalismus fokussierte Erhebung der Friedrich-Ebert-Stiftung hat sich 2021 der Frage gewidmet, wie eben jenes Vertrauen noch weiter gesteigert werden kann. Die Ergebnisse lassen sich gleichermaßen auf Content Strategien anwenden. Ihnen zufolge kann das Vertrauen bei Nutzerinnen und Nutzern erhöht werden, wenn abgesehen von qualitativ hochwertigen Inhalten auch Community-fördernde Formate, wie die Möglichkeit zur Hinterlassung eines Kommentars, Diskussionsforen oder Voting-Tools zum Einsatz kommen. Mithilfe dieser können sich die Mitglieder bei der Medienkonsumation entspannen, bei Bedarf aber auch „mitreden“.
Print bleibt in Erinnerung
Es zeigt sich, dass Online-Unternehmen massiv von Printprodukten profitieren können. So lässt sich beobachten, dass es nach der Veröffentlichung neuer Printausgaben zu Traffic- und Absatzsteigerungen auf den zugehörigen Websites kommt. So auch bei Manufactum, einem Unternehmen der OTTO Group, das mit seinen hochwertigen und von Medienmachern viel beachteten Katalogen dem Trend folgt. Dafür gibt es Analysen zufolge gute Gründe: In Onlineshops wird meist gezielt nach bestimmten Produkten gesucht, während in Katalogen eher gestöbert und das Ausgesuchte dann online bestellt wird. Ideal gestaltete Printprodukte schaffen zudem Orientierung und einen klaren Rahmen über das Angebot Ihres Unternehmens in der zum Teil reizüberfluteten Onlinewelt.
Print schafft Anerkennung
Um sich von der schnelllebigen Informationsflut des Online-Angebots zu differenzieren, beziehungsweise die Macht von Print effizient auszuschöpfen, müssen wirksame Publikationen hochwertig gestaltet sein. Eine qualitätsvolle Haptik passt dabei nicht nur in das entschleunigte und bewusste Nutzungsverhalten, sondern steigert auch das Unternehmensimage und verleiht den Leserinnen und Lesern ein Gefühl von Exklusivität.
Trotz Voranschreiten der Digitalisierung gibt es zahlreiche Gründe dafür, Print-Publikationen in die eigene Content Strategie mitaufzunehmen. Die Vorteile liegen dabei auf und im besten Fall gut in der Hand.
Bildquelle: sodawhiskey – stock.adobe.com
Haben Sie schon einmal daran gedacht, eine Influencerin oder einen Influencer in den Marketingplan Ihres Unternehmens miteinzuplanen? In diesem Blogbeitrag möchten wir Ihnen die Vorteile für Ihr KMU aufzeigen und hilfreiche Tipps zur Arbeit mit Micro-Influencerinnen und -Influencern geben.
Viele kleine und mittlere Unternehmen (KMU) nutzen bereits zielgruppenspezifische Reichweiten von Influencerinnen und Influencer auf sozialen Medien als Teil der Marketing- und Content-Strategie. Es handelt sich hierbei um Influencerinnen und Influencer, die meist über Blogs, Instagram, YouTube oder Pinterest anhand von Produktempfehlungen und eigenen Erfahrungsberichten einen großen Einfluss auf das Konsumentenverhalten ausüben. Die Ziele einer Zusammenarbeit mit Influencerinnnen und Influencer aus Sicht der Unternehmen sind dabei meist Umsatzsteigerung, Erhöhung des Bekanntheitsgrades und Imageverbesserung. Doch welcher Typus von Influencerin und Influencer ist der effektivste für eine Kampagne, einem Produktlaunch oder der Präsentation einer bestimmten Dienstleistung? Können Sie als KMU bereits mit moderatem Budget Erfolge im Influencer Marketing erzielen? Und vor allem: Wie starten Sie die Form der Werbung? Lassen Sie uns gemeinsam einen Fahrplan aufstellen.
In der Nische liegt die Kraft
„Denken Sie „micro“, wenn Influencer-Marketing richtig gut werden soll “, unterstreicht das Content Marketing Institute von Gründer Joe Pulizzi, einem der renommiertesten Marketing-Experten in den USA, in zahlreichen Beiträgen. Als solche „kleinen“ Influencerinnen und Influencern werden rund 75 Prozent der Instagrammerinnen und Instagrammer bezeichnet, die ihre persönlichen Erfahrungen mit 1.000 bis zirka 10.000 Follower teilen. Diese Botschafterinnen und Botschafter verzichten häufig auf allgemeine Themen und spezialisieren sich in der Regel auf ganz spezifische Nischen, wie spezielle Mode, das Eltern-Sein, Schwerpunkte aus dem Bereich der Gesundheit oder die eigenen Erfahrungen mit Extremsportarten. Auf ihrem spezifischen Gebiet gelten sie als sehr glaubwürdig und können Themen bedienen, die eine bestimmte und fokussierte Zielgruppe erreichen. Mit ihren sogenannten Followerinnen und Followern haben sie meist eine sehr enge, freundschaftliche Bindung und interagieren häufig mit ihnen. Dadurch haben Micro-Influencerinnen und -Influencer eine enorm hohe Like- und Engagement-Rate.
Dies bedeutet somit, dass Influencerinnen und Influencer mit einer großen Community nicht zwingend die bessere Partner-Wahl für Ihr Unternehmen darstellen. Zwar ist eine hohe Anzahl an Followern positiv für die Reichweite, da eine breitgefächerte Zielgruppe angesprochen wird. Andererseits benötigen jedoch die meisten erklärungsbedürftigen Produkte keine übermäßige Werbung, sondern wollen vielmehr ein konkretes Zielpublikum erreichen. Masse bedeutet in vielen Fällen auch Streuverlust, da so unter anderem auch viele Personen mit Werbung bespielt werden, die kein Interesse an den Produkten haben. Immer mehr Unternehmen entscheiden sich daher für „kleinere“ und kostengünstigere Influencerinnen und Influencer, die auf sich auf ein spezielles Themengebiet spezialisiert haben. Micro-Influencerinnen und -Influencer vereinfachen einen zielgruppenspezifischen Einstieg in diese Form des Marketings. Ihre Inhalte wie Blogbeiträgen oder Social Media-Postings geben Ihnen einen Indikator dafür, wie eine zukünftige Kooperation aussehen könnte. Dabei spielen die Übereinstimmung der Zielgruppe sowie der Werte des Unternehmens mit jenen der neuen Werbepartner eine maßgebliche Rolle.
Praxisbeispiel
Sie fragen sich jetzt wahrscheinlich, warum wenig Reichweite gut ist? Um dies besser zu verstehen, müssen Sie sich in Ihr Zielpublikum hineinversetzen. Sie haben beispielsweise ein nachhaltiges Modelabel auf den Markt gebracht, das es bis dato in dieser Form noch nicht gab. Betrachten Sie die Situation aus der Perspektive ihrer potenziellen Kundinnen und Kunden. Stellen Sie sich vor, sie als Käuferin oder Käufer treffen den Entschluss: „Ich kaufe nur noch nachhaltig ein!“. Sie setzen sich mit nachhaltigen Modelabels und Second Hand Läden auseinander, informieren sich bei Informationsabenden oder auf Veranstaltungen darüber und folgen natürlich auch auf den sozialen Medien Personen, die selbst vermehrt oder ausschließlich nachhaltige Mode kaufen. Dabei konzentrieren sie sich auf Informationen aus Österreich oder der DACH-Region, die Ihnen konkrete Tipps und Tricks sowie gezielte Kaufvorschläge geben.
Nach ein paar Monaten folgen Sie auf diversen sozialen Medien nachhaltigen Modebegeisterten, die ihre Erfahrungen mit Ihnen teilen und vertrauen diesen. Genau diese Personen haben über Blogs, Instagram, YouTube oder Pinterest anhand von Produktempfehlungen und eigenen Erfahrungsberichten einen großen Einfluss auf Ihr Konsumverhalten ausgeübt. Auf ihren diversen Kanälen haben sie ihr Wissen, die Vorteile sowie die Nachteile mit Ihnen geteilt. Vor Ihnen liegt gleichzeitig eine Broschüre aus Ihrem Briefkasten, die Sie über einen Shop mit nachhaltiger Mode informiert. Welches dieser vorgeschlagenen Geschäfte werden sie in den nächsten Tagen besuchen? Erfahrungsgemäß vertrauen Käuferinnen und Käufer in solchen Fällen eher der eigenen Nische und weniger der Werbung im Postkästchen.
Aller Anfang ist schwer
Haben Sie das ideale Gesicht für ihre Produkte oder Dienstleistungen gefunden haben, dann schreiben Sie dieser Person eine E-Mail oder greifen Sie zum Hörer und führen ein persönliches Telefongespräch.
Machen Sie sich keine Sorgen, falls Sie keine Antwort in Ihrem Postfach finden. Manchmal sind zwei oder drei Anläufe notwendig, um zu unterstreichen, dass Ihnen die Zusammenarbeit wichtig ist. Trauen Sie sich mit Influencerinnen und Influencern auf Augenhöhe zu sprechen, da sie ein gemeinsames Ziel verfolgen: Mehr Aufklärung anhand von Storytelling für ein bestimmtes Thema zu schaffen, um genau dieses Zielpublikum zu erreichen!
Über Geld spricht man nicht? Doch!
Wenn Sie im Marketing tätig sind oder viel mit Kommunikation zu tun haben, wissen Sie, dass es seine Zeit dauert, einen guten Blogbeitrag oder ein ansprechendes Posting zu erstellen. Die Liebe fürs Detail sowie ein zielgruppenspezifisches Netzwerk zeichnen eine gute Influencerin oder einen guten Influencer aus. Eine kostenlose Influencer-Kooperation als selbstverständlich zu sehen, ist daher nicht sehr fair! Wir empfehlen, die einzelnen Kooperationen persönlich zu besprechen, eventuell schon im Vorfeld nach einem Mediakit, einer digitalen Info-Mappe, die alle wichtigen Informationen für potenzielle Werbekunden enthält, auf der Webseite der Influencerin oder des Influencers Ausschau zu halten oder ganz einfach das Thema Geld offen anzusprechen. Offene Kommunikation von Anfang an, hilft Missverständnisse aus dem Weg zu räumen und eine gute Bindung aufzubauen.
Qualität vor Quantität
Qualität ist alles! Die Verantwortung der Inhalte liegt jedoch nicht nur in den Händen der Influencerin oder des Influencers, sondern auch bei Ihnen. Wirksame Beiträge zu schaffen, bedarf einer guten Kommunikation und Beziehung der Kooperationspartner. Sobald Sie eine positive Antwort auf eine Anfrage zur Zusammenarbeit erhalten haben, ist es ratsam in einem persönlichen Gespräch oder per Videochat die zukünftige gemeinsame Arbeit und den erwarteten Output zu besprechen. Schlagen Sie konkrete Themen vor: Ein gutes Briefing ist essenziell. Legen Sie während dieser Gespräche die Keywords und Schwerpunkte fest. Es muss außerdem klar definiert werden, welche Wörter oder Themen aufgrund der Unternehmensleitlinie nicht erwähnt werden dürfen. Geben Sie den Influencerinnen und Influencern trotzdem künstlerische Freiheit, damit sie der Kreativität freien Lauf lassen können. Zu häufig genannte Marken- oder Produktnamen machen kein gutes Bild. Auch bei werblichen Social Media-Beiträgen muss immer der zum Produkt passende Content im Mittelpunkt stehen, um von Followerinnen und Followern als vertrauenswürdige Empfehlung aufgefasst zu werden.
Bedenken Sie bei den Kooperationen mit Influencerinnen und Influencern außerdem, dass gemeinsame Ziele verfolgt werden, die auf folgenden Punkten basieren:
- Aufmerksamkeit für das Thema schaffen
- Mit dem Zielpublikum interagieren
- Reichweite aufbauen
- Schaffung von Kaufreizen bei einem Produkt oder einer Dienstleistung mit hohem Erklärungsbedarf.
Nutzen Sie die zielgruppenspezifische Reichweite und das Know how der Influencerinnen und Influencer, um mehrere unterschiedliche Social Media-Kanäle zu bespielen – und vergessen Sie nicht, die Inhalte auch über ihre Unternehmensseiten auf den sozialen Medien zu teilen. So schaffen Sie sich ein Netzwerk und erreichen zahlreiche potenzielle Kundinnen und Kunden, die Interesse an Ihrem Unternehmen und Ihren Produkten haben.
Bildquelle: unsplash.com
In einer digitalen Welt, die stark auf visuelle und auditive Reize setzt, werden sehbehinderte, blinde oder gehörlose Menschen oft ausgeschlossen. Dabei gibt es Untertitel für Videos und Bildbeschreibungen für Fotos, die für Inklusion auf Social Media sorgen. Hier finden Sie einen Überblick über konkrete Tools, die Ihnen dabei helfen, Ihre Postings auf Instagram und Facebook möglichst barrierefrei zu gestalten.
Die Lippen bewegen sich, aber die sprechende Person bleibt stumm. Das perfekt belichtete Instagram-Bild ist plötzlich nichts als ein verschwommener Fleck. Und der kreative Titel wird als eine Kombination von willkürlich zusammengewürfelten Zahlen und Buchstaben angezeigt. Was die meisten sofort an technische Probleme denken lässt, ist für viele Menschen mit Seh- oder Hörbehinderungen der Regelfall auf Social Media.
In Österreich leben über 300.000 blinde und sehbehinderte Personen sowie weitere 460.000, die gehörlos sind oder eine andere Hörbeeinträchtigung haben. Während viele Websites bereits barrierefrei gestaltet sind, bleibt auf Social-Media-Kanälen noch viel Luft nach oben. Und das, obwohl es in den Sozialen Medien ganz besonders wichtig ist, ein möglichst breites Publikum zu erreichen. Im Idealfall sollen Followerinnen und Follower den Content nicht nur sehen oder hören, sondern ihn auch teilen, liken und kommentieren. Inklusion auf Instagram, Facebook und Co. ist also eine klare Win-Win-Situation für alle.
Mehr Inklusion auf Social Media. So geht’s:
Wollen Sie erreichen, dass auch Menschen mit Behinderungen Teil Ihrer Social Media Community sein können, gestalten Sie Ihre Postings wahrnehmbar, verständlich und für technische Hilfsmittel geeignet. Behalten Sie immer im Hinterkopf, dass vor allem Sehbehinderte sogenannte Screenreader benutzen, die ihnen Texte im Internet vorlesen. Bilder und Grafiken mit Bildbeschreibungen oder Alternativtexten versehen, damit sie der Screenreader lesen kann. Für Videos wiederum eignen sich Untertitel zum Abbau von Barrieren. Social Media-Plattformen bieten oft eigene Tools für Untertitel und Bildbeschreibungen an, manchmal ist es jedoch von Vorteil, auf eine externe App zurückzugreifen.
Untertitel auf Social Media? Auf jeden Fall!
Von Untertiteln profitieren nicht nur Hörbeeinträchtigte, sondern auch das hörende Publikum. Ob unterwegs in den Öffis und die Kopfhörer nicht dabei,am Abend vorm Fernseher nur kurz die Neuigkeiten gecheckt oder eine Lese-Präferenz – 85 Prozent der Videos in den Sozialen Medien werden aus verschiedenen Gründen ohne Ton abgespielt. Da Videos mit Untertiteln demnach eine größere Chance haben, angesehen zu werden, werden sie auch häufiger geteilt.
Untertitel für Instagram erstellen:
Für IGTV können Untertitel automatisch erstellt werden:
- Gehen Sie zu Ihren Profil-Einstellungen
- Klicken Sie auf „Konto“
- In der Option „Untertitel“ können Sie diese nun aktivieren
- Öffnen Sie die IGTV-App
- Wählen Sie das gewünschte Video sowie den Titel aus
- Gehen Sie zu „Erweiterte Einstellungen“. Hier nochmals „Automatisch erstellte Untertitel aktivieren“ auswählen.
Für Instagram Stories gibt es noch kein hauseigenes Tool zum Erstellen von Untertiteln. Alle unten genannten Apps können die Untertitel mittels Texterkennung automatisch erstellen. Diese können auch nachträglich selbst bearbeitet und auf Fehler überprüft werden. Aufgenommen wird direkt im Story-Format:
- Clips für iPhone
Die kostenfreie App erstellt Untertitel „live“ beim Filmen, verschiedene Schriftarten können ausgewählt werden. Der Text wird zudem im passenden Rhythmus eingeblendet. Clips besticht besonders durch verschiedene Filterfunktionen, wie zum Beispiel einem Augmented Reality Effekt. Videos können direkt in der App aufgenommen oder aus dem Album hochgeladen und zusammengeschnitten werden.
- Clipomatic für iPhone
Die gleichen Funktionen wie bei Clips sind auch bei Clipomatic verfügbar. Die App ist jedoch nur kostenpflichtig erhältlich. Zusätzlich kann hier jedoch im quadratischen Format aufgenommen werden, die Untertitel werden in 40 verschiedenen Sprachen unterstützt.
- AutoCap für Android
Mit AutoCap ist auch für Android eine App verfügbar, die Untertitel mittels Spracherkennung automatisch erstellt. Mit einem Abonnement können Sie zusätzlich eine Übersetzungsfunktion nutzen.
Untertitel für Facebook erstellen:
Bei Facebook ist keine App notwendig. Untertitel können nach dem Upload manuell angelegt oder beim Hochladen automatisch erstellt werden.
Für die manuelle Option müssen Sie Ihr Video zuerst transkribieren und in eine SRT-Datei übertragen. Eine SRT-Datei enthält den Videotext mit den entsprechenden Zeitangaben. Das soll darüber Auskunft geben, wann was gesagt wird. Wie Sie eine SRT-Datei erstellen, erfahren Sie hier. Ist diese Vorarbeit erledigt, gehen Sie auf Facebook wie folgt vor:
- Wählen Sie Ihr Video zum Hochladen aus.
- Wenn es vollständig geladen ist, klicken Sie seitlich auf die Option „Subtitles & Captions“.
- Klicken Sie im Menü, das sich öffnet, auf „Hochladen“. Hier können Sie nun Ihre SRT-Datei hochladen.
SRT-Untertitel können auch für Videos, die bereits gepostet wurden, nachträglich hochgeladen werden. Die entsprechende Option finden Sie über die drei Punkte unter dem Video.
Das automatische Erstellen von Untertiteln funktioniert ähnlich:
- Wählen Sie Ihr Video zum Hochladen aus.
- Sobald es vollständig geladen ist, klicken Sie seitlich auf die Option „Subtitles & Captions“.
- Legen Sie im Menü, das sich öffnet, die Videosprache fest.
- Klicken Sie darunter auf „Automatisch generieren“.
- Wenn die Untertitel von Facebook fertig erstellt wurden, können Sie diese über das Bleistift-Symbol bearbeiten.
Bildbeschreibungen & Alternativtexte. So geht’s:
Blinde Menschen benutzen häufig Screenreader, die Schriftliches im Internet vorlesen können. Damit nun Bilder vom Screenreader in Sprache „übersetzt“ werden können, muss ein entsprechender Text vorhanden sein, der beschreibt, was auf dem Bild zu sehen ist. Auch Menschen mit eingeschränkter Sehkraft können den Alternativtext nutzen. Oft ist es auch für sie einfacher, diesen zu lesen, als das Bild in aller Klarheit zu erkennen.
Achten Sie beim Erstellen der Bildbeschreibungen bzw. Alternativtexte auf Social Media darauf, dass Sie im Text nicht abermals auf visuelle Reize setzen (z.B.: „So sieht unser neuer Rucksack aus.“), sondern Sie den Inhalt des Bildes anschaulich und klar beschreiben. Screenreader können auch Emojis übersetzen (z.B. „Person im elektrischen Rollstuhl“). Werden mehrere Emojis hintereinander benutzt, kann dies jedoch schnell verwirrend werden.
Die alternative Bildbeschreibung können Sie dem Posting auf Instagram und Facebook direkt hinzufügen.
Alternativtext für Instagram erstellen:
Instagram generiert mittels Objekterkennungstechnologie Bildbeschreibungen für Screenreader prinzipiell automatisch. Setzen Userinnen und User einen Screenreader ein, kann dieser Bilder automatisch „übersetzen“. Da solche automatischen Beschreibungen aber oft sehr einfach und stichwortartig sind, ist es ratsam, einen benutzerdefinierten Alternativtext zum eigenen Posting hinzuzufügen. Den Alternativtext erstellen Sie bei Instagram direkt im Upload-Prozess, nachdem Sie die gewünschten Filter und Effekte ausgewählt haben. So gehen Sie dabei vor:
- Wählen Sie Ihr Bild und bearbeiten Sie es.
- Tippen Sie vor dem finalen Upload auf „Erweiterte Einstellungen“
- Scrollen Sie hinunter zu „Barrierefreiheit“ und gehen Sie zu „Alternativtext eingeben“
Alternativtext für Facebook erstellen:
Für Facebook gilt ebenso wie für Instagram: Die Social Media-Plattform kann eine Bildbeschreibung für Screenreader mittels Objekterkennungstechnologie automatisch generieren. Wollen Sie sichergehen, dass diese auch wirklich verständlich ist, sollten Sie aber selbst einen Alternativtext erstellen. Klicken Sie dazu einfach auf „Foto bearbeiten“ und wählen Sie „Alternativtext“. Bei bereits geposteten Fotos können Sie den Alternativtext nachträglich über „Optionen“ in der unteren rechten Ecke des Bildes ändern.
Wichtig: Je nach Beeinträchtigung (z.B. Lernschwächen, Farbenblindheit oder Autismus) können neben Untertiteln und Bildbeschreibungen auch andere Maßnahmen notwendig sein, um Barrierefreiheit auf Social Media herzustellen. Inklusion auf Social Media kann zum Beispiel auch bedeuten, Bildtitel in Einfacher Sprache zu formulieren, Emojis und Farben nur sparsam zu verwenden oder auf spezielle Textformate zurückzugreifen.
Bildquelle: WavebreakMediaMicro – stock.adobe.com
In diesem Beitrag wollen wir uns dem Thema Content Marketing etwas fortgeschrittener widmen, beginnend mit der Frage, wie durch die Wahl der richtigen Keywords ein hohes Ranking der eigenen Inhalte in der Google Suche erreicht werden kann.
Ein wichtiger Faktor ist hierbei die „Keyword-Recherche“. Darunter verstehen wir ein Set von Techniken inklusive des Einsatzes entsprechender Tools, um die richtigen beziehungsweise besten Suchworte und -phrasen zu identifizieren. Ideal sind in diesem Fall Worte oder Phrasen, die Userinnen und User verwenden würden, wenn Sie genau nach jenen Inhalten suchen, die auf der entsprechenden Webseite angeboten werden. Für diesen Artikel könnte das etwa sein: „Keyword-Recherche leicht erklärt“.
Die richtigen Suchbegriffe finden
Das bringt uns zur zentralen Aufgabenstellung in der Keyword Recherche: Zu verstehen und zu durchschauen, wie Userinnen und User ticken, wenn sie suchen. Diese Sichtweise ist uns schon beim Thema Customer Journey begegnet und tatsächlich ist Keyword-Recherche eine wichtige Methode beim Versuch, Userinnen und User an möglichst vielen Touch-Points abzuholen.
Nehmen wir die Top-Suchbegriffe auf Google im Jahr 2019 (für Österreich): Die Plätze 1-4 („Strache“, „Notre Dame“, „Dominic Thiem“ und „EU-Wahlergebnisse“) sind vor dem Hintergrund der Nachrichtenlage gut erklärbar. Nummer 5: „iPhone 11“. Anzunehmen gewesen wären Suchbegriffe wie „iPhone 11 kaufen“ oder „iPhone 11 neue Funktionen“, aber bloß „iPhone 11“? Würde jemand, der Allgemeines über das iPhone 11 wissen will, nicht einfach auf die Apple Homepage gehen und sich informieren? Offenbar eher weniger.
Was ist eigentlich das Suchergebnis von „iPhone 11“? An erster Stelle Apple selbst, gefolgt von den üblichen Verdächtigen in E-Commerce und Mobilfunk; die Plätze 1-20 zeigen eigentlich keine Überraschungen. Bei „iPhone 11“ handelt sich um ein sogenanntes „Short-Tail Keyword“, das sind sehr allgemeine, sehr häufig verwendete Suchwörter. Und auch sehr unspezifische, denn sie lassen kaum Rückschlüsse zu, was die Userin/den User zu seiner Suche bewegt hat.

In dem Zusammenhang wird auch gerne das Bild des „Funnels“ (Trichter) herangezogen: Oben kommen in den Trichter alle Userinnen und User rein, die ein bestimmtes Thema verfolgen (Aufmerksamkeit/“Attention“). Nach unten verdichtet sich dann die Motivlage und das Involvement – aus Attention wird Interesse („Interest“), schließlich Verlangen („Desire“). Das klassische AIDA Modell, an dessen Ende beim Ausgang des Trichters, die Action, also meist ein Kauf, steht. Personen, die Short-Tail Keywords verwenden, stehen meist ganz oben im Funnel.
Was nicht ausschließt, dass ein kleiner Teil von ihnen sehr schnell kaufbereit ist. Deshalb machen solche Keywords für Angebote Sinn, die eine entsprechende Breite von möglichen Motiven abdecken können – wie die großen E-Commerce Shops. Amazon, MediaMarkt und Co bieten umfassende Informationen zum iPhone, User-Ratings und Vergleiche, dazu Top-Preise und gegebenenfalls sogar Service. Wer also nach „iPhone“ sucht, ist bei diesen Playern heiß begehrt, egal wie stark die Kaufintention der Person tatsächlich schon ausgeprägt ist. Hauptsache, sie landet erst mal im eigenen Shop und kann mit Tracking-Cookies, Newsletter und Social Media auf ihrer User-Journey begleitet und beeinflusst werden.
Für die meisten Unternehmen machen „Short-Tail“ Keywords nur wenig Sinn. Sie sind besser beraten, sich mit „Mid-Tail“ und „Long-Tail“ Keywords zu beschäftigen – etwa: „iPhone Display austauschen“. Diese sind weit spezifischer und lassen wesentlich besser auf das Suchmotiv der Userinnen und User schließen.
Tools zur Keyword-Recherche
Google stellt mit dem Keyword Planer ein kostenloses Tool zur Verfügung, das dabei unterstützt, sich einen Überblick über verfügbare und relevante Keywords zu verschaffen, inklusive Zahlen über die Häufigkeit ihrer Verwendung in Suchen.
Daneben gibt es unzählige weitere Software für die Keyword-Planung, etwa Ubersuggest oder Keyword.io. Neben Analyseinformation helfen diese mit Thesaurus Funktion auch bei der Suche nach inhaltlich passenden Sprachvarianten, also etwa „iPhone 11 Display reparieren“ oder „iPhone 11 Bildschirm kaputt“.
Fazit: Bei der Recherche und Festlegung von Keywords steht jedenfalls der Leitgedanke des Content Marketing im Vordergrund: Es geht immer um die Userin/den User. So sollten nicht nur Marketers denken, so denken vor allem die Software Genies von Google. Mit ihren Artificial Intelligence Algorithmen sind diese nämlich längst in der Lage, die tatsächliche Bedeutung eines Keywords für einen Text zu beurteilen und diesen entsprechend weit vorne (oder hinten) im Suchergebnis zu zeigen. Womit es letztlich auf den Inhalt selbst ankommt.
Bildquelle: 2019 JOSEP SURIA - Adobe Stock, unsplash.com
Haben Sie schon einmal die Redensart „ein Bild sagt mehr als tausend Worte“ gehört? Natürlich, wer nicht! Tatsächlich ist diese Floskel aber nicht nur so dahingesagt. Fotografien, Grafiken, Illustrationen, Videos, Memes – oder kurz gesagt „Visual Content“ – vermittelt Informationen an unser Gehirn, die rund 60.000-mal schneller verarbeitet werden können als reine Textinhalte. Und sie bleiben deutlich länger und besser – selbst drei Tage später noch ganze fünf bis sechs Mal besser – in Erinnerung. Wer Content-Marketing betreibt, sollte den Fokus also nicht nur auf gelungene Texte legen, sondern auch Visual Content sinnvoll einsetzen. Wie Ihnen das gelingt? Das sehen wir uns nun näher an.
Bilder als Kundenmagnet
Durch gut gewählte und passende Bilder können Sie wirkungsvoll die Aufmerksamkeit der Kundinnen und Kunden auf Ihre Brand lenken, mehr Traffic und Interaktionen generieren wie auch länger in Erinnerung bleiben. Noch effektvoller als starre Fotografien oder Grafiken sind dabei Videos oder GIFS, da sich der Mensch von Natur aus von Bewegungen anzogen fühlt und der Blick so schnell zum gewünschten Ort gelenkt werden kann. Bilder jeglicher Art erzählen Geschichten, die ihre Marke außerdem für die Audience erlebbar machen, Gefühle vermitteln, Vertrauen aufbauen und somit Ihre Glaubwürdigkeit erhöhen.
Wussten Sie, dass etwa 80 Prozent der Kaufentscheidungen unbewusst durch Sinneseindrücke wie eben Bilder getroffen werden? Aber auch online performen Websites und Werbungen, in die Bilder oder Videos eingebunden sind, deutlich besser als bilderlose Pendants. Marketer sollten daher die Wirkung von symbolstarkem Visual Content nicht unterschätzen.
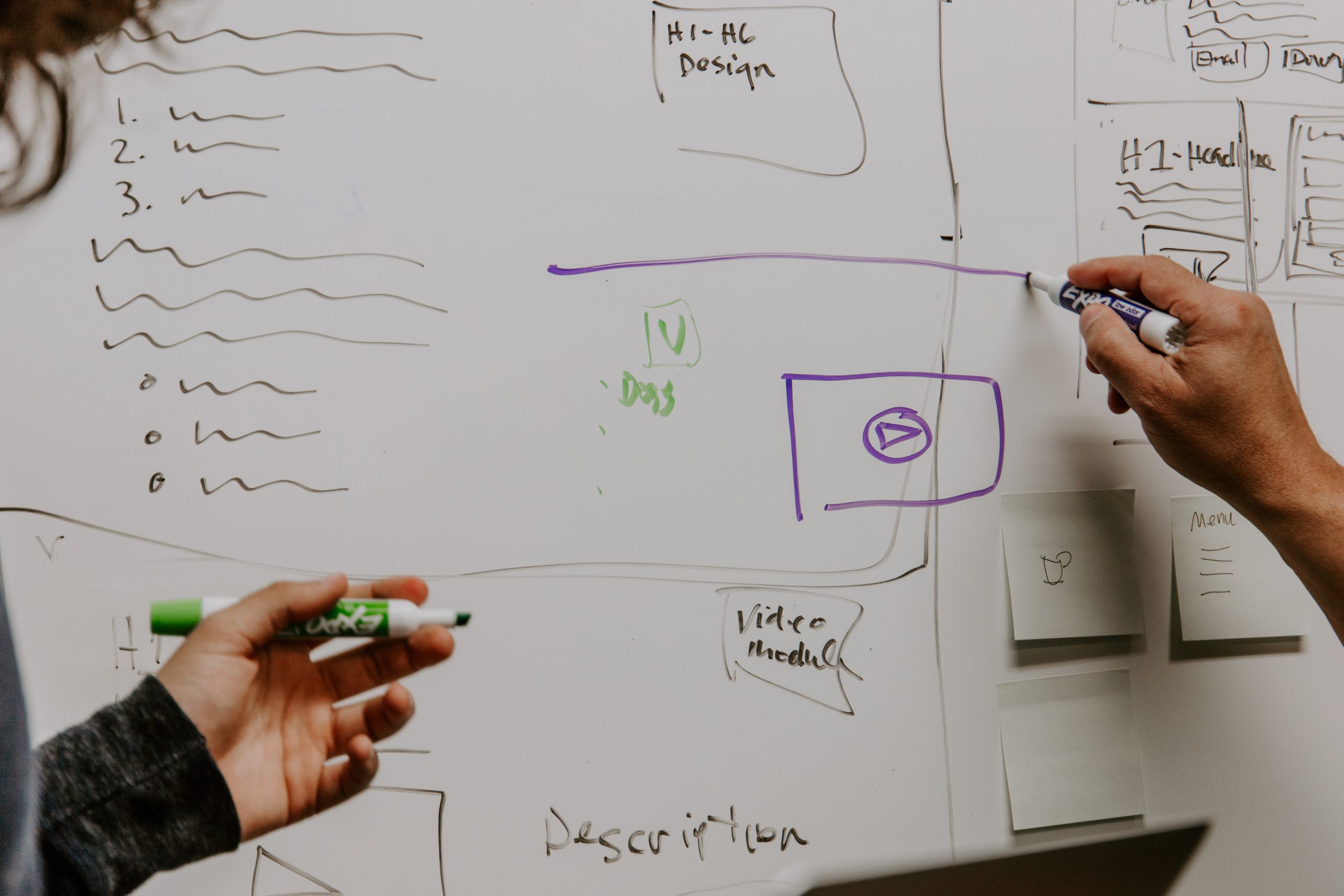
Bild ist nicht gleich Bild
Einfach nur irgendein Bild zu verwenden, macht natürlich keinen Sinn. Der wissenschaftlich belegte „Picture Superiority Effect“ – die Überlegenheit des Visuellen – funktioniert nur, wenn Text und Bild zusammenpassen. Eine starke und vor allem persönliche Bildsprache – Stockfotos sind manchmal durchaus geeignet, wirken aber oftmals auch etwas hölzern – eine gute Bildqualität und die passende Grafik-Wahl zum Sujet spielen eine große Rolle dabei, wie das Bild von ihrer Custom Audience aufgenommen wird.
Daneben haben jedoch auch noch viele andere Faktoren eine Auswirkung auf die Reaktionen der potentiellen Kundinnen und Kunden, wie eine Studie der Österreich Werbung am Content Day 2019 erhob. Die Wahl des Visual Content muss zur Markenidentität und ihrem Image, aber auch zur Zielgruppe passen. Außerdem sollte sich die Bildsprache gleichbleibend mit sich wiederholenden Elementen präsentieren, um den Wiedererkennungswert der Brand zu steigern. Das alles zu beachten kann manchmal eine Herausforderung für Unternehmen darstellen. Ein relativ einfach zu befolgender Hilfsanker ist dabei, das Google-Ranking der eigenen Bilder durch einen treffenden Dateinamen und eine passende Bildbeschreibung gespickt mit Keywords zu beeinflussen. So werden Ihre Fotos, Videos, Grafiken und Co. leichter bei der Bilder- und Videosuche auf Google auffindbar – Tools, die sich im Laufe der Zeit als besonders beliebt herausgestellt haben.
Achten Sie im Internet auch auf die Bildrechte ihres Visual Contents, sofern Sie ihn nicht selbst erstellt haben, um Konsequenzen zu vermeiden.
Visual Content platzieren
Beim Visual Content-Marketing gibt es zahlreiche Stolpersteine, aber auch unzählige Möglichkeiten, seine Brand richtig und wirksam in Szene zu setzen. Es ist vor allem wichtig, immer auf dem Laufenden zu bleiben, denn in Zeiten von Instagram, Pinterest und TikTok – Social Media Kanäle, die sich auf visuellen Content in verschiedenen Formaten spezialisiert haben – sind Grafiken, wie Memes oder GIFs, so schnell aus der Mode wie sie aufgetaucht sind.
- Auf Social Media: Besonders aus der eben erwähnten Social-Media-Ecke kennen wir auch das Platzieren von visuellen Medieninhalten in einem News-Feed oder als Pinnwand. Eine besonders gängige Methode des Visual Content Marketing, mit der Unternehmen auf besagten Social-Media-Seiten schon lange nicht mehr alleine sind. Aber auch auf Facebook, LinkedIn und Twitter erzielen Beiträge mit Bildern mehr Aufmerksamkeit als nur reiner Text. Achten Sie jedoch darauf, je nach sozialem Netzwerk auch die richtige Bildgröße zu verwenden.
- In Blogs: In einem Firmen-Blog wie diesem hier, helfen beispielsweise Grafiken nicht nur wichtige Informationen leichter verständlich zu machen, sondern auch Texte aufzulockern – immerhin lesen Internet-Userinnen und User nur 28% des Texts auf einer Seite. Außerdem werden Blogbeiträge durch visuellen Content sichtbarer, denn Bild- und Videosuchmaschinen leiten den Traffic dorthin, wo sie ihn haben wollen.
- Auf Websites: Nicht nur in Blogs sind daher Bilder, Grafiken und Videos nützlich, um mehr Informationen an seine potenziellen Kundinnen und Kunden heranzutragen. Auch auf Websites fesseln Bilder ihre Gäste schneller als eine Textwüste. Mehr als die Hälfte von Website-Besuchern verlassen diese nämliche bereits nach 15 Sekunden wieder – zu kurz, um lange Texte zu lesen und auch noch zu verstehen. Mit Bildern und Videos optimiere Websites generieren zwischen 20-60 % zusätzlichen Traffic.
Es gibt also viele Möglichkeiten und Orte, seine Marke in der digitalen Welt durch visuelle Inhalte zu präsentieren und ihren Bekanntheitsgrad zu steigern. Dabei entwickeln sich diese stetig weiter, werden diversifizierter und komplexer.
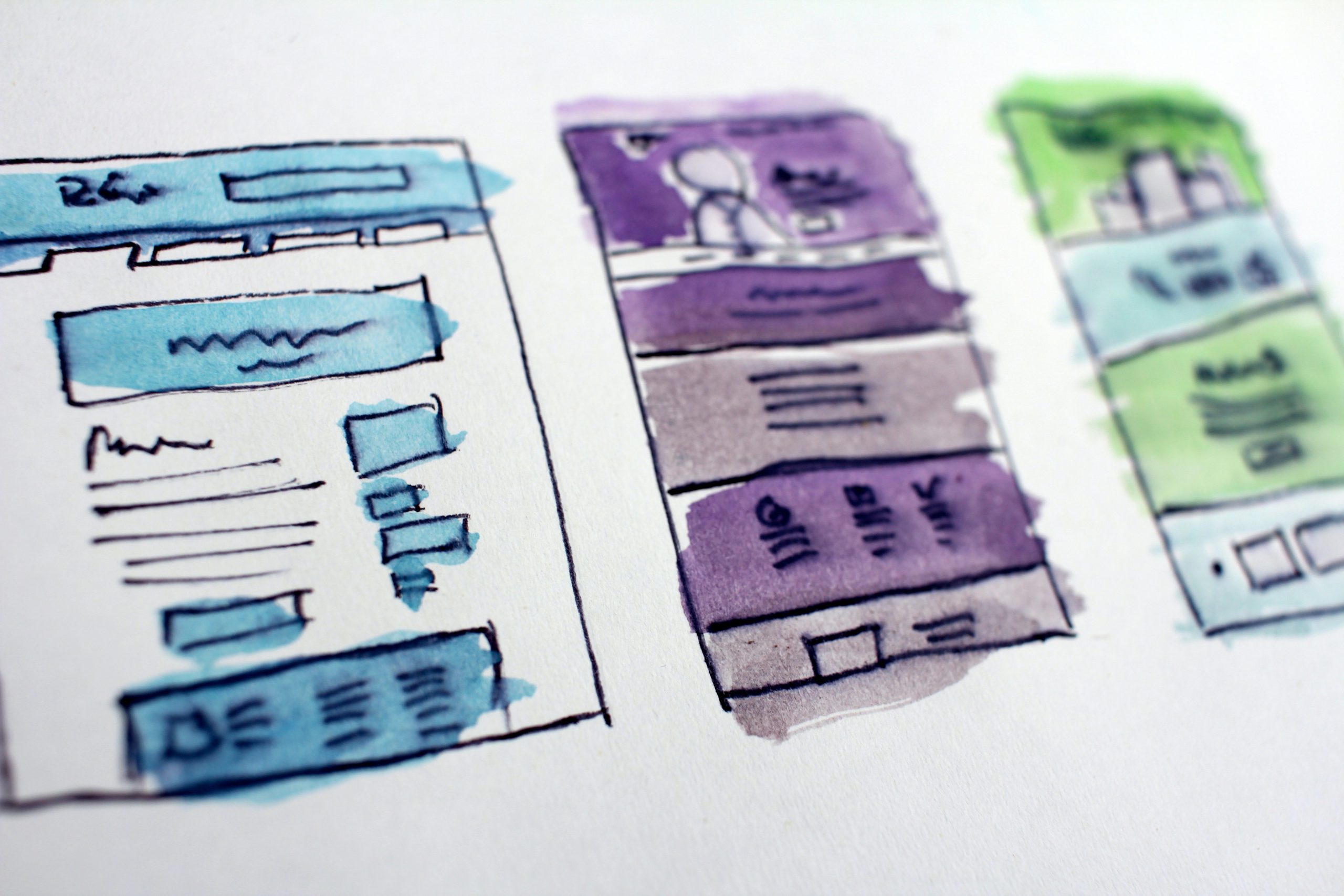
TIPP:
Mit diesen Programm-Beispielen können Sie einfach und kostenlos Collagen, Grafiken oder Videos für Ihren Marktauftritt erstellen und bearbeiten:
Grafiken und Collagen
- Canva: Der bekannte Online-Editor ist ideal, um Grafiken oder Collagen zu erstellen. Leider sind aber viele Funktionen nur in der bezahlten Version zugänglich.
- Crello: Dieser Editor ist Canva sehr ähnlich, allerdings bietet er mehr kostenlose Funktionen und stellt gleich zu Beginn alle gängigen Formate mit passender Beschriftung zu Auswahl.
- Adobe Spark: Im Gegensatz zu vielen anderen Adobe-Produkten ist Adobe Spark kostenlos, aber auch ein wenig komplexer als Canva oder Crello. Dafür steht Userinnen und Usern eine Datenbank mit unzähligen Bildern und Grafikelementen zu Verfügung.
Videobearbeitung
- Powtoon: Das Programm ist übersichtlich und bietet Userinnen und Usern viele fertige Elemente und Werkzeuge, um etwa Erklärvideos zu erstellen.
- Renderforest: Auch Renderforest stellt viele Vorlagen zur Verfügung, in der bezahlten Version kann hier sogar ein Voice Over-Tool genutzt werden.
- Shotcut: Das Profi-Programm bietet alle Standardtools zur Bearbeitung ihres Videos und darüber hinaus auch einige Effekte, Animationen und Filter.
Schaubilder und Infografiken
- easel.ly: Das Programm kann direkt im Browser genutzt werden und muss nicht erst heruntergeladen werden. Schaubilder und Infografiken sind schnell und einfach erstellt.
- piktochart: Auch piktochart kann online genutzt werden, ist aber eher zum Erstellen von Infografiken praktisch.
- Visme: Mit dem Programm können visuelle Markenerlebnisse ganz einfach auch von Neulingen auf dem Gebiet erstellt werden.
Bildquelle: Yok_Piyapong - Adobe Stock, unsplash.com
Der Versand von Newslettern ist eine klassische Maßnahme des Online-Marketings. Laut einer Prognose von Statista.com soll sich die Anzahl der täglich versendeten und empfangenen E-Mails weltweit im Jahr 2020 auf 306,4 Milliarden belaufen. Damit Ihr Mail in dieser Flut nicht untergeht, braucht es das richtige Tool.
Qual der Wahl bei der Newsletter-Tool-Suche
Der Text ist geschrieben, die Zielgruppe definiert, die E-Mail-Adressen sind vorhanden und die Kampagne kann starten: Doch welches Tool ist das richtige, um das Mailing zu den Kundinnen und Kunden zu bringen und gelesen zu werden? Auf der Suche wird bald klar: Programme zum Versenden von Newslettern gibt es zuhauf, es herrscht die Qual der Wahl. Ein Blick auf die Features und Funktionen hilft, eine qualifizierte Auswahl zu treffen. Wir stellen Ihnen vier E-Mail-Marketing-Tools vor.
Weit verbreitet: Mailchimp
Großer Beliebtheit erfreut sich der US-Dienst Mailchimp. Die cloudbasierte Software mit dem Schimpansen-Logo wird laut eigenen Angaben von 13 Millionen kleinen Unternehmen genutzt. Diese sind die Hauptzielgruppe für die Plattform, auf der neben dem E-Mail-Kampagnen-Tool auch Zielgruppen-Tools, kreative Tools sowie Automatisierungstools angeboten werden.
Was kann Mailchimp?
- Dank vorgefertigter Layouts und zusätzlicher Design-Tools – die klar strukturiert sind – können Anfängerinnen und Anfänger individuelle Newsletter erstellen.
- Die umfangreiche Galerie mit E-Mail-Vorlagen dient als zusätzliche Inspirationsquelle, die Bedienung des Drag&Drop-Editors zur Umsetzung der Templates wie auch eigener Ideen funktioniert intuitiv.
- Mit der kostenlosen Version können bis zu 2.000 Abonnentinnen und Abonnenten monatlich mit insgesamt 10.000 E-Mails beschickt werden – einen kleinen Werbebanner muss man dafür in Kauf nehmen. Mailchimp empfiehlt die „Standard“-Version um 12,57 Euro, der „Premium“-Tarif um 250,82 Euro umfasst außerdem einen (englischsprachigen) Telefonsupport.
- Achtung: Um das gesamte Potential nutzen zu können, muss man die englischen Anleitungen und Fachbegriffe lesen und verstehen können.
Europäische Alternative: Sendinblue
Eine europäische Alternative für den Newsletter-Versand ist Sendinblue. Das in Paris gegründete Unternehmen arbeitet cloudbasiert und bezeichnet sich als All-in-One-Marketingplattform. 180.000 Agenturen, Start-ups, NGOs, Unternehmen und E-Commerce-Händler in 160 Ländern greifen bei ihren Marketing-Maßnahmen laut Eigenangaben auf die Dienste von Sendinblue zurück.
Was kann Sendinblue?
- Newsletter erstellen, gestalten und versenden – und das im Handumdrehen: Das verspricht Sendinblue dank vorgefertigter Templates, auch neue Designs sind per Drag&Drop-Editor leicht umsetzbar. Als Ergänzung können SMS-Marketing-Nachrichten erstellt werden.
- Die Tools sind intuitiv anwendbar, bei Fragen helfen (deutschsprachige) Video-Tutorials, die auf der Homepage des Unternehmens zu finden sind, weiter.
- Sendinblue bietet ein kostenloses Paket für Einsteigerinnen und Einsteiger an. Damit können bis zu 300 E-Mails pro Tag an unbegrenzte Kontakte verschickt werden. Marketing-Einsteigern wird das „Lite“-Paket um 19 Euro pro Monat empfohlen, das „Premium“-Paket um 49 Euro pro Monat richtet sich an Profis. Das „Enterprise“-Paket inkludiert alle angebotenen Features inklusive einem „persönlichen Ansprechpartner“, der Preis wird auf Anfrage verraten.
- Sendinblue hat eigenen Angaben zufolge seinen Serverstandort in Deutschland. Die Nutzerdaten, die gespeichert werden, fallen also unter das deutsche beziehungsweise europäische Datenschutzrecht. Rechtssicherheit habe einen hohen Stellenwert.
Newsletter plus Event-Management: Eyepin
Auf große Marken wie Austrian Airlines oder Daimler als Referenzkunden verweist das in Berlin und Wien stationierte Unternehmen Eyepin. Neben E-Mail-Marketing bietet der zertifizierte Datenverarbeiter Unterstützung beim Event-Management, bei Umfragen, Gewinnspielen und beim Kontaktmanagement per SMS. Aktuell werden Lösungen für die Organisation und Abwicklung von Covid-Impfungen angeboten.
Was kann Eyepin?
- Eyepin bietet eine webbasierte Softwarelösung zur Erstellung der Newsletter an: Die Usability kommt Anfängerinnen und Anfängern entgegen, die Datenbereiche sind übersichtlich angeordnet und erlauben eine rasche Erstellung von Kampagnen. Durch dynamische Inhalte in den Newslettern kann individuell auf einen Empfänger eingegangen werden.
- Bei den Designs gibt es Layoutvorlagen, die an die eigene CI (Corporate Identity) angepasst werden können, individuelle Layouts werden selbst oder auch von Eyepin erstellt.
- Besonders betont werden bei Eyepin Service und Beratung. Tauchen Fragen auf – egal ob zu den Tools oder zu anderen Themen – kann direkter Kontakt zu Beraterinnen und Beratern aufgenommen werden.
- Zu den Preisen für den Service gibt es auf der Eyepin-Website keine Informationen, dieser wird individuell vereinbart.
Betreuung inklusive: Emarsys
Das österreichische Unternehmen Emarsys bezeichnet sich als „Omnichannel Customer Engagement Plattform“ – denn Kontakt wird über viele Kanäle aufgebaut. Das Nutzer-Engagement wird etwa für die Sprachlernplattform Babbel gesteigert, eine Dienstleistung für den Sportartikelhersteller Puma Europe ist die Skalierung des E-Mail-Versands mit neuen CRM-Strategien. Weltweit kümmern sich 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter um 2.200 Kundinnen und Kunden.
Was kann Emarsys?
- Die kanalübergreifende Kundenbindung beinhaltet E-Mail-Marketing: Mails werden als wichtigster Engagement-Kanal jeder Marketingstrategie gesehen. Die Contenterstellung erfolgt schnell, Vorkenntnisse sind nicht notwendig.
- Neben der Optik wird viel Augenmerk auf die Personalisierung von Mails durch „Open Time Content“ gelegt. Dynamischer, sich in Echtzeit verändernder Content – wie Lagerverfügbarkeit oder frühere Suchergebnisse – über Widgets hinzugefügt, soll die User-Experience verbessern.
- Auf der Website gibt es Webinare, Podcasts und Blogbeiträge mit Best-Practice-Beispielen darüber, wie Marketing und Kundenbindung funktionieren.
- Zu den Preisen für den Service gibt es auf der Emarsys-Website keine Informationen, dieser wird individuell vereinbart. Support wird rund um die Uhr angeboten.
Erst der Vergleich macht sicher
Bereits dieser kurze Überblick zeigt, dass die Entscheidung für ein Newsletter-Tool von vielen Faktoren abhängt. Der Preis mag ein Faktor sein, dieser kann sich durch zusätzlichen Support oder mehr Service natürlich nach oben bewegen. Grundsätzlich gilt, einige Fragen vorab zu beantworten: Haben Sie Vorkenntnisse oder gehören Sie zu den Anfängerinnen und Anfängern? Wollen Sie selbst einen Newsletter verschicken, oder diese Aufgabe auslagern? Sind Sie zufrieden mit schlichten Designs, oder suchen Sie das Außergewöhnliche? Von den Antworten hängt ab, welches Tool das Richtige für Sie ist.
Bildquelle: memyjo- stock.adobe.com
Stellen Sie sich vor, Sie haben einen Gast zu sich nach Hause eingeladen. Als dieser aber zur Tür reinkommt, wirft er nur einen kurzen Blick in Ihren Vorraum, macht auf der Fußmatte kehrt und geht wieder. Ohne weitere Worte. In der digitalen Welt hat dieser Gast ihrer Website soeben die Bounce Rate um einen Zähler erhöht. Nicht so gut…
Schon von „Bounce“ gehört?
„To bounce“ heißt eigentlich zurückprallen. Was die Sache nicht exakt im Kern trifft, denn ein „Bounced Visit“ prallt an nichts zurück – der Visitor geht von selbst. Im Grunde genommen misst die Bounce Rate nichts anderes als den Anteil jener Visits (oder Sessions, wie es in Google Analytics heißt) einer Website, die nur einen Seitenaufruf (Page Impression) generieren. Das ist streng technisch zwar nicht ganz präzise, für den Zweck dieses Beitrages sei uns diese Vereinfachung aber gestattet.
Was ist nun eine gute beziehungsweise akzeptable Bounce Rate und ab wann sollte man beginnen, sich Sorgen um die Performance der eigenen Website zu machen? Genau diese Frage stellte uns neulich eine Kundin und in der Hand hielt sie ihre aktuelle Google Analytics Auswertung: 35% Bounce Rate. Gut oder schlecht? Sie war der Meinung, dass es doch Wahnsinn sei, wenn einer von drei Seitenbesuchen nicht weiter als zu eben der besuchten Seite kommt.
Ist es nicht. Jedenfalls nicht zwangsläufig. Denn zur Interpretation der Bounce Rate sollte man einen Schritt tiefer gehen.
Die Sache mit dem Websitetyp
Da wäre zunächst die Frage, um welchen Typ von Website es sich handelt. Informationsseiten, im Besonderen jene mit Magazincharakter, also längere Storys, haben typischerweise eine höhere Bounce Rate. Das liegt an mehreren Faktoren, etwa an der Herkunft des Traffic. Kommt eine Userin oder ein User über die organische Suche oder einen dedizierten Link auf eine bestimmte Story, so ist das ja kein Zufall, sondern genau jenes Verhalten, das wir erreichen wollen: Sie suchen Information, wir haben diese Information. Die Userin und User finden uns und konsumieren die Information. Mission erfüllt. Es ist keineswegs überraschend, dass es für sie überhaupt keinen Grund gibt, eine weitere Story zu konsumieren.
Bei E-Commerce Seiten liegt die Sache allerdings etwas anders. Der Vergleich zum physischen Geschäft drängt sich auf: Interessierte sehen etwas im Schaufenster, gehen in den Laden, finden das Produkt doch nicht so toll und gehen wieder raus, ohne vom Verkaufspersonal gefragt zu werden, ob es vielleicht was anderes sein darf. E-Commerce Seiten mit hohen Bounce Rates schaffen es zwar, Käuferinnen und Käufer anzuziehen, aber nicht, diese durch das Angebot zu führen. Hier besteht Handlungsbedarf.
1, 5 oder 10 Minuten?
Auch der Faktor Zeit ist ein Thema bei der Beurteilung der Bounce Rate – die Seitenverweildauer ist quasi deren Antagonist. Denn ein Bounce ist ein Bounce, gleich ob der Aufenthalt auf der Seite 20 Sekunden oder 10 Minuten gedauert hat. Bei längeren Artikeln oder Produktlisten mit Konfiguratoren und dergleichen ist letzteres durchaus denkbar – und wünschenswert. Dass schließlich eine Userin oder ein User, die viel Zeit auf einer Seite verbringen, noch mehr Zeit für eine weitere Seite haben, darf nicht unbedingt erwartet werden. (Für die technisch Interessierten an dieser Stelle die Information, dass die Zählung eines Bounce mit einer Zeitdauer parametriert werden kann: So werden dann nur Visits als Bounce gezählt, die etwa kürzer als fünf Sekunden waren.)
Natürlich ist es in jedem Fall wünschenswert, eine eher niedere als eine eher höhere Bounce Rate zu verzeichnen.
Was kann man also tun? Hier einige Tipps:
- Schaffen Sie einen attraktiven und verlockenden Einstieg in Ihren digitalen Content mit prägnanten Headlines, schnell lesbaren Abstracts und einprägsamen Bildern. Geben Sie Userinnen und Usern eine schnelle und gute Antwort auf die Frage: Warum bin ich hier und verbringe hier meine Zeit?
- Überlegen Sie gut, welche Links Sie anbieten: Wenn Sie zu Storys verlinken, dann zu jenen, die nachweislich gut funktioniert haben, etwa auf Social Media. Bei Produkten sollten Ähnlichkeiten oder logische Beziehungen gegeben sein.
- Vermeiden Sie Textwüsten auf Seiten. Lockern Sie Texte mit Bildern und Grafiken auf. Das Auge will lieber sehen als lesen. Vermeiden Sie möglichst inhaltsleere Stillleben aus dem Stock-Bilder Bestand, setzen Sie auf Menschen, Tiere, Emotionen.
- Analysieren Sie die Quelle Ihres Site-Traffic. Gibt es Unterschiede in den Bounce Rates oder einzelnen Quellen? Wenn dem so ist (wie häufig der Fall): fördern, promoten oder kaufen Sie Traffic verstärkt von jenen Quellen, die niedriger „bouncen“.
- Entfernen Sie Datumsangaben aus Ihren Storys, soweit diese im Kontext nicht zwingend nötig sind – oder updaten Sie Angaben bei der Content-Pflege. Dieser Text etwa entstand im April 2021, er hätte aber ebenso Gültigkeit, wenn er im April 2017 entstanden wäre, würde dann aber von vielen sofort als zu alt abgelehnt werden.
Der wahrscheinlich wesentlichste Unterschied zwischen traditioneller Werbung und Content Marketing ist die Wiederholfrequenz ein und derselben Botschaft. Ziel ersterer ist es, simple Messages in die Köpfe möglichst vieler zu bekommen. Im Content Marketing wollen wir exakt das Gegenteil erreichen, nämlich Zielgruppen mit immer neuen Informationen unterhalten und informieren. Die Redaktionsplanung hat dabei eine Schlüsselfunktion: Sie definiert was, wann und wo publiziert wird und vor allem wie oft. Wie das gelingen kann, sehen wir uns nun näher an.
Der Weg zum Redaktionsplan
Es gibt unterschiedliche Herangehensweisen und noch mehr Möglichkeiten, einen Redaktionsplan abzubilden. Inhaltlich existiert aber ein klarer gemeinsamer Nenner: Welche Linie verfolgt das Content Marketing und wer soll damit angesprochen werden? Letzteres, die Zielgruppe, ist dabei der weit einfachere Teil. Wird diese doch eine Etage höher, als Teil der Marketingstrategie insgesamt, definiert.
Etwas kniffliger ist da schon jener rote Faden, der in der Print-Welt als „Blattlinie“ bezeichnet wird. Jene unverkennbare Handschrift in Themensetzung und Schreibstil, die den Inhalt dem Absender zuordenbar machen. Und genau das soll ja erreicht werden, nämlich mit einem Themenfeld assoziiert zu werden und daraus Vorteile für die eigene Unternehmens- bzw. Markenposition, insbesondere gegenüber dem Mitbewerb zu entwickeln. Das Problem dabei: Kaum ein Unternehmen bewegt sich in einem Umfeld, das per se Berichtenswertes hervorbringt. Die wenigen Ausnahmen haben einen Startvorteil – man denke etwa an einen Zoo, der praktisch täglich putzige Tiergeschichten lancieren kann. Oder auch Kultureinrichtungen mit ihren fast täglichen Vorstellungen und Bühnen Celebrities.
Abseits von Schönbrunn und Burgtheater heißt es über den Tellerrand blicken und Themenfelder definieren, in denen man sich zuhause und kompetent fühlt. Für eine Fluglinie könnten es Reiseberichte, Restaurantempfehlungen und City Guides sein, für eine Haarpflegemarke Styling- und Mode-Tipps und für einen IT-Dienstleister Profi-Tricks im Umgang mit MS Office. Wichtig ist, dass es eine natürliche, logische und klare Brücke zwischen Unternehmen bzw. Marke und Themenfeld geben muss. Diese darf nicht zu offensiv und plump sein, das würde die wahrgenommene Objektivität gefährden, aber auch nicht zu vage, um die Assoziation überhaupt erst möglich zu machen.
Das gewählte Themenfeld muss ebenso interessant wie relevant für die Zielgruppe sein. Ob man sich bei der Bewertung dieser Faktoren auf Hausverstand und Erfahrung oder auf Marktforschungsergebnisse beruft, ist eigentlich gar nicht so entscheidend. Schließlich ist das A und O erfolgreichen Contents dessen konkrete Aufbereitung. Man kann das tollste Thema in Langeweile „zerschreiben“ und umgekehrt aus manch‘ einer Nebensächlichkeit Sensationelles herauskitzeln.
Was in den Redaktionsplan gehört
Für die Content Marketing Praxis der meisten Unternehmen empfiehlt sich eine Jahresbetrachtung, die selbst bei einwöchiger Periodizität noch einigermaßen übersichtlich ist. Das sind die Spalten der Matrix. In den Zeilen werden die Zielmedien geführt, wie sie in der Content Marketing Strategie definiert wurden: Webseite, Blogposts, Podcasts, Print, Social Media (nach Kanälen), Video, Drittmedien.
Weitere wichtige Informationen im Redaktionsplan:
- Publikationsanlässe und -termine: Wöchentlich am Freitag, jeder erste Mittwoch im Monat, täglich im Advent, etc. Sie werden markiert und müssen gefüllt werden.
- Storys mit Thema, Verfasser, Format, Genre sowie eine Liste von Storyideen, die noch konkreten Terminen zuzuordnen sind, gegebenenfalls mit Hinweis auf Parameter, die die Relevanz beeinflussen (z.B. es liegt Schnee oder nicht), mit entsprechenden Alternativen.
- Farbcodes für Sub-Themen: Beim Themenfeld Gesundheit wären das etwa „Ernährung“, „Bewegung“, „Spiritualität“, „Krankheiten“, „Vorsorge“ usw. Das Farbbild der Matrix gibt ein visuelles Gefühl dafür, ob die Sub-Themen im richtigen Mix stehen.
- Publikationsabhängige Termine im Workflow sowie deren Status: Redaktionsschluss, Freigabe, Promotion, Offline-Stellung, Archivierung, usw.
Das traditionelle Marketing kennt eine überschaubare Zahl von Kommunikationskanälen: elektronische und gedruckte Massenmedien, Drucksorten, Dialogmarketing. Mangels Rückkanal hat man nur eine vage Vorstellung davon, welches Medium welchen Beitrag zum Kommunikationserfolg leistet und noch weniger weiß man, auf welchem davon wann potenzielle Adressaten anzutreffen wären.
In der Onlinewelt ist diese Frage nicht unbedingt einfacher zu beantworten, aber es stehen uns mit Analytics, Cookies & Co. leistungsfähigere Tools zur Verfügung. Dazu kommt der Shift im Informationsverhalten von analog zu digital: An die Stelle von Fachzeitschriften treten spezialisierte Websites mit tagesaktueller Information und umfangreichen Testberichten. Die Verkäuferin oder der Verkäufer im Geschäft wird zum KI-gesteuerten Produktkonfigurator. Und zum Erfahrungsbericht von Freunden und Bekannten kommen die Kommentare völlig Fremder sowie die Postings von thematisch versierten Bloggerinnen und Bloggern hinzu.
Die Kundenreise verstehen
Bei der Customer Journey geht es darum, all diese analogen und digitalen Kontakt- oder Berührungspunkte („Touchpoints“) vom ersten Produktinteresse bis zum tatsächlichen Kauf zu verstehen und – soweit möglich – zu adressieren. Dem liegt eine Weiterentwicklung der AIDA-Formel zugrunde, wonach sich die Touchpoints auf fünf Phasen verteilen:
- Awareness: Bewusstsein für ein Angebot wird geweckt
- Favorability: Interesse für das Angebot wird verstärkt
- Consideration: Eine Kaufabsicht wird erzeugt
- Intent to Purchase: Die Kaufabsicht wird verstärkt
- Conversion: Der Kauf wird umgesetzt
Bei rein digitalen Customer Journeys kann die Reise der Kundin bzw. des Kunden mittels Tracking Technologien im Idealfall lückenlos nachvollzogen werden. Wie kam die Person auf die Webseite? Wie oft kam sie vor dem Kauf wieder? Wo war die Person zwischen diesen Visits? Welche Werbeformate haben sie erreicht und wie oft? Daten über Daten. Die Herausforderung besteht darin, sie zu einem sinnvollen Ganzen zu ordnen und interpretierbar zu machen – Stichwort „Big Data“.
Insgesamt stellt E-Commerce aber den weit kleineren Teil des Geschäfts dar, in fast allen Branchen dominiert nach wie vor der Ladenkauf. Was die Analyse der Customer Journey weit komplizierter macht, denn auf ihrem Weg liegen ein oder mehrere Medienbrüche. Da heißt es, kreativ werden und sich jener Schnittstellen zu bedienen, die die analoge und die digitale Welt miteinander verbinden.
Bonusprogramme etwa, die so attraktiv gestaltet sind, dass deren Teilnehmer sie möglichst aktiv nutzen, sodass ein maximaler Anteil ihrer analogen Käufe aufgezeichnet werden kann. Die Verbindung zum digitalen Teil der Customer Journey erfolgt über die Online Registrierung und über Folgebesuche, etwa um Prämien abzurufen (die oftmals wiederum digital sind). Auf diese Weise wird eine 360° Sicht der Customer Journey möglich, was solche crossover gültigen Daten extrem wertvoll macht. Und die Auslobung attraktiver Goodies und Preisvorteile erlaubt, was wiederum das Bonusprogramm stärkt.
Kunden mittels Content Marketing abholen
Neben den Datenaspekten spielt aber auch Content Marketing eine große Rolle in der Customer Journey. Wenn es nämlich darum geht, potenzielle Käuferinnen und Käufer an den relevanten Touchpoints mit entsprechender Information zu versorgen und „abzuholen“. Dabei geht man vor allem heuristisch vor und orientiert sich am typischerweise anzunehmenden Informationsverhalten bestimmter Zielgruppen.
Nehmen wir als Beispiel In-Ear Kopfhörer für Android Endgeräte (also nicht Air Pods, Apple steht längst über Themen wie Customer Journey…):
- Awareness: Die Message wäre zum Beispiel an dieser Stelle: „Du kannst nun auch für Dein Samsung Handy weiße In-Ear Bluetooth Headphones bekommen.“ Die Bekanntmachung von neuen Produkten ist ein entscheidender erster Schritt, vor allem bei Technologie. In zeitgemäßen Kampagnen erfolgt diese nicht unbedingt als ein „Big Bang“, sondern oft in Stufen, beginnend vielleicht mit gezielten Leaks von Prototypen und Vorankündigungen. Dem folgt die Ansprache der Early Adopter über die von solchen primär frequentierten Webseiten und Apps. Erst danach, vielleicht mit ein wenig Zeitabstand, geht es an eine breite tech-affine Zielgruppe. Jede dieser Maßnahmen umfasst bestimmten Content – Texte, Bilder, Videos. Erwünschte Reaktion des Konsumenten: „Klingt interessant und vielversprechend.“
- Favorability: Die Message hier: „Diese In-Ear Headphones schlagen alles, was Du bislang an Kopfhörern hattest.“ Die Welt weiß, dass es das Produkt gibt. Nun setzt das Storytelling ein und hebt Features, Design, Brand Emotion und alle anderen kaufrelevanten Produkteigenschaften hervor. Die Kommunikation ist sach- und faktenorientiert und spielt sich über Medien ab, die möglichst hohes Ansehen haben. Dazu kommen Testvideos, die die Eigenschaften bestätigen. Erwünschte Reaktion: „Das scheint ja wirklich zu funktionieren.“
- Consideration: Die Botschaft lautet nun: „Die Headphones liegen voll im Trend. Sieh mal, wer sie alles hat.“ Hoch mit den Wunschmotiven, runter mit Risikowahrnehmung und sonstigen Dissonanzen, heißt es in dieser Phase. Werbliche Kommunikation allein erreicht dieses Ziel nur schwer, neutrale Quellen sind die ideale Ergänzung. Nutzerberichte, Testimonials und alles, was das Angebot trendy und „must-have“ macht. Es geht nicht nur darum, was gesagt und geschrieben wird, sondern wer das tut und wo. Mit anderen Worten: Nicht nur die Redaktion von Content, sondern vor allem dessen Distribution ist in dieser Phase von entscheidender Bedeutung. Die Reaktion: „Ich glaube, das will ich haben.“
- Intent to Purchase: Was hier vermittelt werden soll: „Eine gute Gelegenheit, zuzuschlagen.“ Auf der Zielgerade in Richtung Kaufentscheidung wird nichts mehr dem Zufall überlassen. Die Person befindet sich bereits weit fortgeschritten im Sales Funnel, ist hellwach und reagiert aufmerksam auf Information, die eine Rolle für ihre Kaufentscheidung spielen. Dabei ist eigentlich jedes Mittel recht: Preisaktionen und andere Vorteile, aber auch die nochmalige Bestätigung des bereits Gesagten – Produktvorteile und Co. Wo diese Informationen zu platzieren sind, sagen uns zu diesem Zeitpunkt bereits die bis dahin gesammelten Daten.
- Conversion: Der Olymp des Digital Commerce – das Kommunikationsziel wurde erreicht. Tatsächlich ist die Endstation der Customer Journey auch der einzige Punkt am Weg, der sich zweifelsfrei nachweisen lässt. Egal ob analog oder digital.
Bildquelle: snowing12 - stock.adobe.com
Gesetzestexte und Gerichtsentscheidungen sind für Laien (und sogar manchmal für Juristen) nur selten auf den ersten Blick verständlich. Lange Schachtelsätze, veraltete Rechtsbegriffe und ausschweifende Begründungen wirken da oft kontraproduktiv. Rechtliche Inhalte können aber auch verständlich und kompakt vermittelt werden, wenn bestimmte Punkte beachtet werden. Folgend ein kurzes „How To“.
Irgendwo zwischen erster Vorlesung und Sponsion verfestigt sich unbemerkt das sogenannte Juristendeutsch in den Köpfen der Jus-Studentinnen und -Studenten. Meist kommen sie erst darauf, wenn Außenstehende sie verständnislos anschauen, sobald Begriffe wie „juristische Person“ oder „Organ“ in einer normalen Unterhaltung fallen. Der Laie fragt dann schnell: Wie kann eine Person „natürlich“ oder gar „juristisch“ sein? Neben den Fachbegriffen sollte man sich auch der anderen Tücken der deutschen Rechtssprache bewusstwerden, um sie dann erfolgreich zu beseitigen.
Rechtliche Sprache vereinfachen
Für Juristinnen und Juristen vielleicht haarsträubend, schafft die Verwendung von alltagstauglicheren Begriffen Abhilfe. Soweit es im konkreten Fall rechtlich irrelevant ist, die Lage aber verständlicher macht, könnte man etwa die rechtlich falsche „Firma“ statt dem gemeinten „Unternehmen“ verwenden. Auch „Besitzer“ statt „Eigentümer“ würde sich anbieten. Generell könnte man sich bei bestimmten juristischen Feinheiten zurückhalten, um das Gegenüber nicht weiter zu verwirren.
Weitere Möglichkeiten, um die rechtlichen Inhalte verständlicher aufzubereiten:
- Verzicht auf doppelte Verneinungen: nicht unstrittig/nicht unzweideutig, besser: strittig/zweideutig
- Zeitwörter statt Hauptwörter: Findet Anwendung/unter Beweis stellen, besser: anwenden/beweisen
- unrichtig/nicht ausgeschlossen/herrenlos, besser: falsch/möglich/verloren etc.
- hat zu prüfen/ist zur Prüfung verpflichtet, besser: muss prüfen
- Liegenschaft, besser: Grundstück
- binnen einer Frist, besser: innerhalb einer Frist
Juristinnen und Juristen sind für ihre bedeutungsschweren Schachtelsätze bekannt. Steht dann noch das Verb am Ende des Satzes, kann es um die Aufmerksamkeit der Leserinnen und Leser geschehen sein. Also lieber:
- Kurze Sätze
- Das Verb am Anfang
- Lieber Aktiv- statt Passivform
- Bulletpoints oder Tabellen für Voraussetzungen, Formvorgaben, Fristen etc.
Unser Tipp für Präsentationen
Setzen Sie bei Präsentationen Tools richtig ein! Power Point Folien sollen die Vortragende/den Vortragenden unterstützen, nicht verdrängen. Gesetzeszitate, Entscheidungen und Rechtsausführungen sollten daher lieber den interessierten Zuhörerinnen und Zuhörern als Handout verteilt oder als PDF verschickt werden. Die wenigsten Zuhörer sind nämlich in der Lage, überladene Folien sinnerfassend zu lesen und gleichzeitig zuzuhören.
Stattdessen kann Power Point eingesetzt werden für:
- schematische Darstellungen (wie Instanzenzüge oder Verfahrensabläufe)
- Zahlen
- Rechtsquellen
- Literaturverweise
Inhaltlich sollte man sich auf das konzentrieren, was für das Gegenüber konkret relevant und interessant ist. Das bedeutet vor allem:
- Überblick über Ziel und Zweck der relevanten Rechtsvorschriften
- Konkrete und praxisrelevante Beispiele
- Fragen direkt und konkret beantworten
- Keine historischen Rückblicke, akademischen Debatten und langen Rechtsausführungen
Schlussendlich geht es darum: rechtliche Inhalte sind oft komplex. Es empfiehlt sich daher, sie auf das Wesentliche herunterzubrechen und kurz zu fassen. Praxisrelevante Beispiele machen die Problematik für die Ansprechpersonen greifbar und verständlich. Wenn man also die oben genannten Regeln beachtet, kann auch ein juristischer Fachtext verständlich und interessant dargestellt werden.
Bildquelle: Nattakorn - stock.adobe.com
Sie möchten einen Corporate Podcast starten, wissen aber noch nicht wie? Keine Sorge! Bekanntlich ist aller Anfang schwer. Wir haben daher 5 wichtige Tipps & Tricks für Sie, die Ihnen helfen werden, Ihren Podcast erfolgreich umzusetzen.
Gleich einmal vorweg: Mit Ihrer Idee, einen Corporate Podcast ins Leben zu rufen, liegen Sie schon mal im Trend der Zeit. Immer mehr Unternehmen nutzen das aufstrebende Audioformat als Mittel zur internen Kommunikation und auch als Marketingkanal. Denn das Besondere an Podcasts ist, dass sie zeit- und ortsunabhängig gehört werden können, es außerdem ermöglichen, direkt auf die gewünschte Zielgruppe einzugehen und durch Vertriebskanäle, wie Streaming-Plattformen (z.B. Spotify und iTunes) die Reichweite zu erweitern. Durch gezieltes Storytelling und bestimmte Podcast-Formate, wie Serien, können Marken über einen längeren Zeitraum die hohe Aufmerksamkeitsspanne der Hörer nutzen, idealerweise das Vertrauen der Hörerinnen und Hörer gewinnen und somit auch gleichzeitig die Brand Awareness positiv steigern.
Bei all den Vorteilen stellt sich natürlich die Frage, wie sich ein Corporate Podcast auch wirklich erfolgreich umsetzen lässt? Ein Blick in den Digital News Report des Reuters Institute zeigt, dass bereits knapp 32 Prozent der befragten Österreicherinnen und Österreicher Podcasts nutzen, seit dem Vorjahr gibt es hier sogar einen Anstieg von 4,4 Prozent. Durch das wachsende Interesse an Podcasts gibt es aber auch immer mehr Konkurrenz. Ihr Podcast muss also gut sein und Aufmerksamkeit generieren, um sich von der Masse abzuheben. Wie Ihnen das gelingen kann, sehen wir uns jetzt genauer an.
1. Content ist King: Erstellen Sie einen genialen Content-Plan
Jedem, der bereits ein bisschen Ahnung von Marketing hat, ist mittlerweile klar: Guter Content ist essenziell, wenn man erfolgreich kommunizieren möchte. Oberstes Gebot ist hierbei die Qualität. Umso wichtiger ist es heutzutage, einen fundierten Content-Plan zu erstellen. Und damit meinen wir: gut durchdacht, strukturiert & mit einzigartigem Content. So lässt sich das umsetzen:
- Was ist das Thema Ihres Podcasts? Bevor ein Content-Plan erstellt werden kann, ist es wichtig, ein Thema für den Podcast zu wählen. Scheuen Sie sich nicht, hier eine Nische zu finden. Das sollten sie auch! Denn bleiben Sie zu allgemein, wissen die Hörerinnen und Hörer nicht, welche Inhalte Sie bei Ihnen finden und warum Sie genau zu Ihnen zurückkehren sollten. Natürlich muss Ihre Nische zu Ihrem Unternehmen passen. Es wird Ihnen wenig helfen, wenn Sie ein Handwerksunternehmen sind und nun Beauty-Tipps geben. Denn vergessen Sie nicht: Wenn Sie Ihren Corporate Podcast als Marketing-Instrument nutzen möchten, also auch Kundinnen und Kunden ansprechen wollen, ist Authentizität gefragt. Nutzen Sie zudem das Wissen, das Sie in Ihrem Unternehmen haben und begeistern Sie mit Inhalten, die widerspiegeln, worin Sie Expertise haben.
- Unique Content: Kreieren Sie einzigartige Inhalte, die die Hörerinnen und Hörer woanders nicht so schnell finden werden. Falls ein Thema bereits mehrfach von anderen Podcasts behandelt wurde, aber sehr beliebt zu sein scheint, finden Sie einfach neue Zugänge zur Thematik. Zeigen Sie eine andere Sichtweise auf, hinterfragen Sie oder betrachten Sie das Thema aus einer neuen Perspektive, vielleicht auch mit anderen Content-Formaten, wie Interviews mit Expertinnen und Experten.
- Zielgruppe: Kennen Sie Ihre Zielgruppe genau! Wen möchten Sie ansprechen und erreichen? Was könnte diese Zielgruppe interessieren? Ihre Inhalte sollten Sie dementsprechend anpassen. Dies ist auch für die Kommunikation an sich essenziell. Möchten Sie zum Beispiel ein jüngeres Publikum erreichen, sollten sie anders auftreten und anders mit ihm kommunizieren, als wenn Sie älteres Publikum als Ihre Zielgruppe wählen. Fragen Sie sich, wann Ihre Zielgruppe Podcasts hört und in welchen Situationen. Beim Kochen am Abend? Oder morgens am Weg ins Büro? Das kann Ihnen helfen, die Veröffentlichung Ihrer Episoden zu timen und die Inhalte dementsprechend anzupassen.
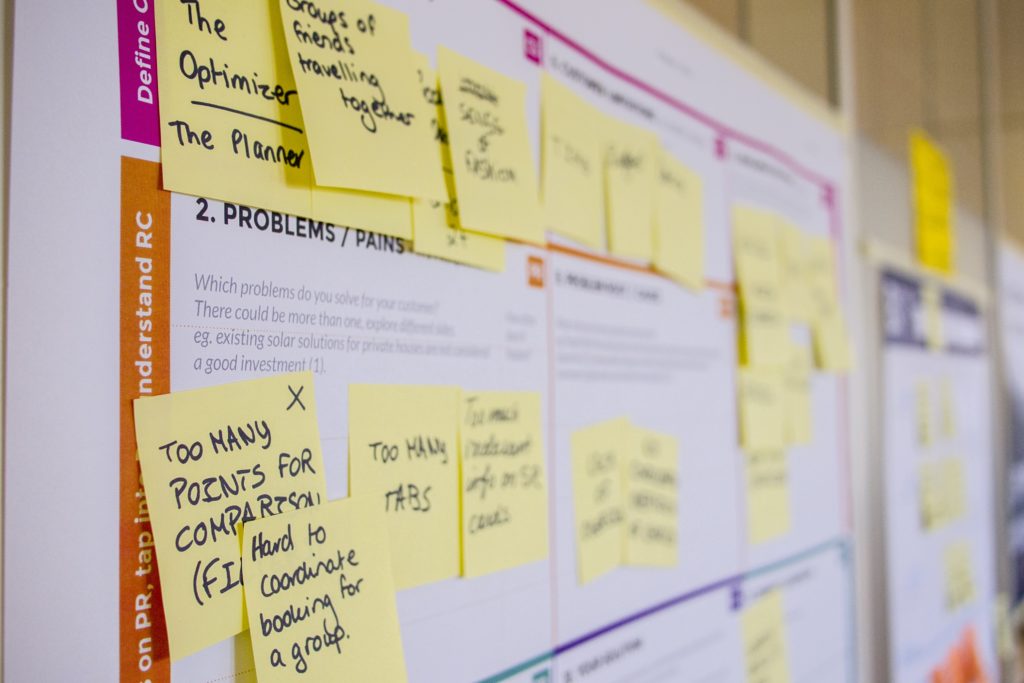
2. Wer setzt den Podcast um? Legen sie die Akteurinnen und Akteure fest
Um mit Ihrem Podcast erfolgreich sein zu können, spielt neben dem Content das Personal, das sich um die Umsetzung kümmert, eine bedeutende Rolle. Sie sollten also genau planen, welche Ressourcen sie benötigen.
- Die Person hinter der Stimme: Je nachdem, wie Sie den Podcast gestalten möchten – ob mit nur einem „Host“ oder mehreren, müssen Sie passende Sprecherinnen oder Sprecher finden. Haben Sie Personal, das eine ansprechende Stimme hat und sich das zutraut? Unsicherheit, Nervosität oder Demotivation hört man einer Stimme an, selbst wenn man die Person hinter dem Mikrofon nicht sehen kann. Und da es sich um ein Audioformat handelt, muss die Stimme überzeugen, damit man gerne zuhört.
- Planen Sie vorausschauend: Das heißt etwa, sie sollten personelle Engpässe, Urlaubszeiten oder berufliche Veränderungen des Personals mitbedenken. Im Idealfall produzieren Sie bei voraussichtlichen Engpässen vor. Mangelt es Ihnen generell an „Inhouse“-Personal können Sie auch auf externe Akteurinnen und Akteure zugreifen. Hier sollten Sie zusätzliche Kosten im Blick behalten, doch die Qualität muss stimmen. Wirklich gute Sprecherinnen und Sprecher, die sich dem Projekt verlässlich widmen, werden sicherlich etwas verlangen. Sparen Sie also nicht an der falschen Stelle!
- Redaktion und Produktion: Ebenso wichtig, wie die Frage nach der „Stimme“ ist jene, wer den Podcast redaktionell betreut und produziert. Wer kennt sich mit dem Unternehmen aus und möchte sich um den Content-Plan, das Konzept und Interviewpartnerinnen und -partner kümmern? Wer weiß mit Mikrofonen, Schnittprogrammen, Akustik und der musikalischen Gestaltung umzugehen?
3. Wählen Sie hochwertiges Podcast-Equipment
Der Qualitätsfaktor ist beim professionellen Podcasting, wie das „Salz“ in der „Suppe“. Nur, dass die „Suppe“ dadurch nicht versalzen werden kann. Im Gegenteil: wer auch beim Equipment auf Qualität setzt, dem werden es die Hörer danken. Das Gute an der Sache ist, dass hier gute Qualität nicht unbedingt teuer bedeuten muss. Abgesehen vom Kauf, gibt es außerdem einige Anbieter, die Mikrofone und das dazugehörige Aufnahmeset vermieten und sogar bei der Aufnahme helfen (z.B. Tonstudios).
- Das Mikrofon: Auch wenn man mit Smartphone oder Laptop Aufnahmen tätigen kann, greifen Sie lieber auf professionelle Mikrofone (wie USB-Mikros) zurück, um eine gute Qualität zu garantieren. Gute Mikros gibt es schon ab 100 Euro (z.B. RODE Podcaster). Vergessen Sie aber nicht das Zubehör, wie Pop-Schutz oder Mikrofonständer. hören Sie sich bei Online-Bestellungen die Soundbeispiele an und lesen Sie die Beschreibungen sowie Bewertungen sorgfältig. Das Mikrofon sollte zur Stimme der Hosts sowie zum Aufnahmesetting passen. Auch auf YouTube finden sich viele Produkttests mit Hörbeispielen.
- Die richtige Software: Es gibt bereits viele gute Software-Lösungen, mit denen Sie Ihren Corporate Podcast schneiden und bearbeiten können. Neben teurer Software gibt es auch eine Auswahl an geeigneter gratis Software, wie zum Beispiel Audacitiy. Ein weiterer Vorteil: das Programm lässt sich schnell lernen und leicht bedienen – ganz ohne komplizierten „Schnickschnack“.
4. Überzeugen mit dem ersten Eindruck
Wie heißt es so schön? Der erste Eindruck zählt! Das trifft auch auf Ihren Podcast zu. Die meisten, die auf der Suche nach neuem Podcasts sind, werden sich nicht durch das ganze Angebot bei Spotify oder iTunes hören. Die Zeit ist den Hörerinnen und Hörern kostbar, weswegen Podcasts auch erst so beliebt geworden sind. Umso wichtiger ist es daher, dass Sie ein paar Regeln befolgen:
- Catchy Podcast-Titel: Wählen Sie einen ansprechenden Titel, der zu Ihrer Zielgruppe, Ihrer Intention und Ihrem Content passt. Er soll Ihnen Aufmerksamkeit verschaffen und einzigartig sein. Checken Sie natürlich auch, ob es bereits Podcasts mit demselben oder einem ähnlichen Namen gibt. Auch Markenrechte sollten gegebenenfalls überprüft werden. Ideal ist es außerdem, wenn Ihr Podcast-Name bereits verrät, welche Themen behandelt werden. Beachten Sie aber dennoch: in der Kürze liegt die Würze. Lange Titel oder gar lange Sätze sollten vermieden werden. Außerdem empfiehlt es sich, den Namen breiter zu wählen, damit Sie später das Themenfeld erweitern können.
- Cover: Häufig wird unterschätzt welche Wirkung das Cover auf potenzielle Hörerinnen und Hörer hat. Da wir Menschen auch visuelle Wesen sind, sollten Sie Mühe und Fingerspitzengefühl in die Kreation eines ansprechenden Covers stecken. Es soll thematisch zu Ihrem Podcast passen und die Bildqualität sollte sehr gut sein. Bedenken Sie auch: Ist der Name Ihres Podcasts am Cover zu sehen? Viele Podcasts bauen den Titel ins Cover ein, damit Hörerinnen und Hörer allein schon durch das Cover wissen können, um welchen Podcast es sich handelt.
- Jingle: Auch hier gilt das gleiche wie fürs Cover: Der passende Jingle für Ihren Podcast sollte zu Ihrem Content und Ihrer Zielgruppe passen. Legen Sie sich hier fest, denn der Jingle sorgt für den Wiedererkennungswert Ihres Podcasts und sollte gut ins Ohr gehen. Lassen Sie Kolleginnen und Kollegen reinhören und fragen Sie nach ihrer Meinung. Hat der Jingle Ohrwurmpotenzial? Wenn ja, dann liegen Sie genau richtig!
5. Hallo und auf Wiedersehen: Vergessen Sie Intro und Outro nicht
Was für den Kinofilm der Trailer ist, ist für den Podcast das Intro. Es bietet einen Vorgeschmack auf das, was kommt. Das Outro ist wie das Ende eines Songs, es schließt ab, was uns vorher ins Ohr ging.
- Überzeugen Sie mit dem richtigen Intro: Wählen Sie das Intro für die aktuelle Episode so, dass die Hörerinnen und Hörer erfahren, was sie erwartet. Gehen Sie dabei aber sorgsam um. Verraten Sie nicht gleich die Pointe. Man soll schließlich auch wirklich reinhören. Wecken Sie jedoch keine Erwartungen, denen Sie nicht entsprechen werden. Hier ist die richtige Balance wichtig. Bei Interviews lässt sich häufig folgendes beobachten: Das Intro wird so gewählt, dass es eine besondere Stelle der Episode, also einen Ausschnitt der Aufnahme zeigt. Der Cut wird dann so gesetzt, dass nicht zu viel preisgegeben wird. Denn auch hier gilt: Das Intro ist lediglich eine Vorschau!
- Bauen Sie auch ein Outro ein: Die Podcast Hörer zu verabschieden gehört genauso zum guten Ton, wie sie zu begrüßen. Mit einem Abspann signalisieren Sie, dass sie am Ende der Episode angekommen sind. Sie können wichtige Infos nochmals kurz zusammenfassen, einen Ausblick auf die nächste Folge geben und so idealerweise Neugierde wecken. Schließlich möchten Sie, dass Hörerinnen und Hörer wieder zurückkehren. Eine beliebte Strategie ist es außerdem, sie zum Schluss mit einem „Call to Action“ zu einer Handlung zu bewegen. Sei es, sich für den Newsletter anzumelden, weiterführende Infos auf der Homepage zu lesen oder für neue Podcast-Themen auf den Social Media Kanälen zu voten. Der „Call-to-Action“ ermöglicht es Ihnen, die Hörerinnen und Hörer zu einer Interaktion mit Ihrem Unternehmen zu motivieren. Übertreiben Sie es aber nicht, die Podcast-interessierte Menschen sind durchaus kritisch und merken schnell, wenn das Ende jeder Folge nach einer reinen Marketingaktion klingt. Bedenken Sie: mit dem Outro bleiben Sie in Erinnerung. Es ist das letzte, was man von Ihrem Podcast hört. Gehen Sie hier also sorgfältig vor.
Je nach Erscheinungsfrequenz und Format Ihres Podcasts werden Sie eine ganze Weile in einem Schnittprogramm verbringen. Daher lohnt es sich, die Software zum Schneiden und Bearbeiten von Podcasts mit Bedacht auszuwählen.
Das Interview ist aufgenommen, der Podcast eingesprochen, aber wie kürzen Sie jetzt die Datei, schneiden Versprecher raus oder fügen Musik, Jingles und andere Audiofiles an den richtigen Stellen ein? Die Auswahl des Schnittprogramms kann für Ihre Arbeitsroutine im Podcasting eine wegweisende Entscheidung sein. In diesem Blogpost haben wir ein paar Überlegungen gesammelt, die Sie dabei bedenken sollten.
Was muss ein Schnittprogramm können?
Für viele beginnt die Arbeit im Schnittprogramm noch vor der eigentlichen Bearbeitung − nämlich mit der Aufnahme selbst. Denn das direkte Aufzeichnen bieten die meisten Audioprogramme an und das gleichgültig ob Sie Ihre Mikrofone per USB-Anschluss oder über eine Audioschnittstelle mit dem Computer verbunden haben (mehr dazu in unserem Blogpost). Dort können Sie etwa die Lautstärke der einzelnen Tonspuren im Menü des Programms anpassen, Korrekturen durchführen oder Audioeffekte anwenden.
Nachdem das Rohmaterial vorhanden ist, beginnt der zentrale Teil der Arbeit: Es werden Teile gekürzt, rausgeschnitten, neu angeordnet oder andere Files eingefügt. Das Kürzen, Trennen, Kopieren und Verschieben von Audiofragmenten funktioniert im Prinzip in allen Programmen ähnlich. Nicht zu unterschätzende Unterschiede können sich jedoch in der Steuerung, dem Auswahlmodus und der Menüführung ergeben.
Wer sich nicht eingehender mit Prinzipien der Tontechnik befassen möchte, sollte auf Optionen zur automatischen Soundoptimierung wie etwa Rauschreduzierung achten. Dies ist allerdings bei Weitem nicht in allen Fällen notwendig. Eine Angleichung aller Tonspuren auf ein Lautstärkelevel für die Ausgabedatei gehört hingegen zum Standard und sollte verständlich in allen gängigen Programmen leicht umzusetzen sein. Sollten Sie in Einzelfällen mit der Qualität Ihrer Aufnahmen nicht zufrieden sein, können Sie Dateien im Nachhinein durch separate Programme zur Verbesserung des Sounds schicken – Ein Beispiel dafür ist Auphonic. Inzwischen bieten aber auch schon Podcasthoster solche Dienste beim Hochladen Ihres Podcasts an.
Gratissoftware vs. kostenpflichtige Programme
Auch wenn Gratisprogramme in wesentlichen Teilen nicht weniger können als kostenpflichtige Software, kann diese ihr Geld mehr als Wert sein. Der Unterschied liegt meist darin, wie einfach, übersichtlich und anwenderfreundlich Funktionen angeordnet sind und durchgeführt werden können. Lässt sich die Oberfläche nach individuellen Wünschen anpassen? Kann die Ansicht verändert werden? Wie intuitiv ist die Menüführung und wie ausgeprägt sind Tastenkombinationen und Shortcuts vorhanden? Diese Fragen mögen auf den ersten Blick nicht entscheidend erscheinen, können in der Praxis allerdings einen großen Unterschied machen und vor allem Zeit und Nerven sparen!
Zu den bekanntesten kostenlosen Schnittprogrammen gehören für Mac-User Apples Garage Band oder Audacity. Für viele Aufgaben sind sie mehr als ausreichend und nicht schwer zu erlernen, doch in der Handhabung bieten andere Programme Vorteile.
Wenn Sie etwa mit Programmen der Adobe Creative Suite vertraut sind, könnten Sie sich eventuell in Adobe Audition schneller zurechtfinden und damit mehr Spaß an der Arbeit haben. Zusätzlich kann sich je nach gewähltem Zahlungsmodell ein Kostenvorteil bieten, wenn Sie bereits andere Programme des Anbieters nutzen.
Eine übersichtliche Benutzeroberfläche mit einer großen Bandbreite an Funktionen und Möglichkeiten bietet auch Hindenburg Journalist. Vor allem für komplexere Projekte mit mehreren Tonspuren ist das ebenfalls kostenpflichtige Programm eine gute Alternative. Über kostenfreie Testphasen können Sie das Angebot finden, das für Ihre Ansprüche und Vorlieben am besten passt.
Von Erfahrung profitieren
Beraten Sie sich vor der Anschaffung eines Programms oder dem Abschluss eines Abos unbedingt mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Denn verfügt jemand bereits über Erfahrungen mit einem bestimmten Schnittprogramm, kann dies enorm hilfreich sein. Wie gut man ein Programm beherrscht, hängt stark von der darin investierten Zeit ab. Einerseits kann es sehr mühsam und zeitaufwendig sein, sich in ein neues Programm einzuarbeiten. Andererseits können in bestimmten Programmen Versierte ihre Erfahrungen mit anderen teilen und so die Fähigkeiten in der Organisation schneller ausbauen helfen. Wenn keine Vorkenntnisse vorhanden sind, finden Sie online ein riesiges Angebot an Video-Tutorials, Einführungen, Tipps und Tricks für konkrete Funktionen zu sämtlichen Programmen, die Ihnen helfen, das nötige Know-How aufzubauen.
Letztlich hängt die Entscheidung für ein Schnittprogramm nicht nur vom Budget, der geplanten Projektgröße und -komplexität oder der Anzahl von Menschen, die an einem Podcast arbeiten, ab, sondern auch von persönlichen Vorlieben und Vorkenntnissen. Für welches Programm Sie sich auch entschließen sollten: Erstens können Sie jederzeit ohne großen Aufwand die Software wechseln und zweitens ist das finanzielle Risiko gerade bei Abo-Modellen nicht besonders groß (achten sie aber auf etwaige Kündigungsfristen).
Ads für KMU und EPU
„Wer suchet, der findet“ heißt es doch so schön. Und finden möchten immer mehr Österreicherinnen und Österreicher online, wo sie nach den besten Angeboten für ihre Anliegen suchen. Am liebsten per Google-Suche, wie zahlreiche Studien belegen. Immer mehr Unternehmen wissen bereits um dieses Nutzerverhalten. Die obersten Positionen in den Suchergebnissen werden immer heißer umkämpft, der Wettbewerb wächst. Oberstes Credo hierbei: die Konkurrenz abhängen und die Nutzer zum eigenen Angebot bringen. Wie auch Ihnen das gelingen kann? Das sehen wir uns jetzt näher an.
Damit man als Unternehmen mit seiner Webpräsenz möglichst weit oben in den Suchergebnissen erscheint, gibt es zwei grundlegende Möglichkeiten: Zum einen die organische Suche, die Suchergebnisse ausspielt, die nicht bezahlt sind. Ein wichtiger Faktor für die Auffindbarkeit ist hierbei die Suchmaschinenoptimierung (SEO). Zum anderen gibt es die bezahlte Suchmaschinenwerbung, abgekürzt auch als SEA (Search Engine Advertising) bezeichnet. Googles Lösung für letzteres ist Google Ads (ehemals Google Adwords). Dabei handelt es um ein Werbesystem, das es Werbenden ermöglicht, mit bezahlten Anzeigen eine höhere Sichtbarkeit unter den Suchergebnissen zu erzielen. Kosten für die Anzeigen entstehen nach dem „Pay-per-Click“-Prinzip, die Anmeldung zu Google Ads an sich ist kostenlos. Werbende zahlen also nur, wenn ein Nutzer auf ihre Anzeigen klickt. Zusätzlich können Anzeigen auch bei Google Suchnetzwerk-Partnern ausgespielt werden. Der Vorteil an Google Ads ist, dass man, wenn man es richtig anstellt, mit seiner Webpräsenz sogar über den organischen Suchergebnissen erscheinen kann und somit den suchenden Nutzern gleich ins Auge springt.
Doch damit das gelingen kann, muss eine Reihe an Regeln beachtet werden. Und da Google stets an seinen Werbeangeboten arbeitet, wird auch das System von Google Ads und seinen Funktionen immer komplexer. Nicht umsonst engagieren viele Unternehmen eigens Agenturen, die sich um die Anzeigenschaltung kümmern. Dies kann jedoch auch mit höheren Kosten verbunden sein, sodass sich vor allem kleinere Unternehmen nicht immer das Engagement einer Agentur leisten können oder möchten. Sie sind also auf sich gestellt und viele schrecken davor zurück, bezahlte Werbung auf Google zu schalten. Erkennen Sie sich hier wieder? Wir haben im Folgenden ein paar wichtige Einsteigertipps für Sie, die Ihnen das Schalten von Suchanzeigen mit Google Ads erleichtern sollen.
Holen Sie sich wichtige Infos ein
Das mag vielleicht banal klingen, doch wer sich vor dem Aufsetzen von Kampagnen in Google Ads ausreichend informiert, liegt klar im Vorteil. So können Sie schon zu Beginn Fehler vermeiden, die sie später teuer zu stehen kommen könnten. Holen Sie daher wichtige Infos ein und klären Sie vorab Fragen wie: Wer hat Zugriff auf das Konto und wie stelle ich das ein? Welche Kontoeinstellungen sind wichtig und wie nehme ich diese vor? Wer verwaltet das Budget? Welche Bezahloptionen sind für mein Unternehmen geeignet? Was sind Keyword-Optionen und welche sind sinnvoll? Wie setze ich mein Budget richtig ein, um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen?
Das kann Ihnen dabei helfen: Google stellt eine Reihe an Hilfsmittel zur Verfügung, damit auch Werbende, die sich erstmals mit der Google Ads Materie beschäftigen, einen besseren Durchblick bekommen:
- Google Ads Leitfaden: Dort finden Sie nützliche Infos und Tipps zu den Grundlagen. Sie erfahren zum Beispiel, wie man Suchnetzwerk-Kampagnen erstellt, Anzeigen für Mobilegeräte optimiert oder Ergebnisse misst.
- Google Ads Community: Wenn Sie nicht weiterwissen, können Sie sich auch der Google Ads Community Fragen stellen. Viele haben häufig ein ähnliches Problem und bereits eine Lösung gefunden, die auch Ihnen weiterhelfen könnte.
- Google Digital Workshops: Google veranstaltet zahlreiche kostenlose Workshops: Von Online-Kursen bis zu Live-Trainings, bei denen Sie auch Fragen stellen können. Hier finden Sie außerdem nicht nur Kurse zu Google Ads, sondern auch zu vielen anderen Themen, wie SEO, Google Analytics oder Programmieren.
- Google Ads auf YouTube: Hier finden Sie zahlreiche nützliche Tutorials, in denen Ihnen beispielsweise erklärt wird, wie Sie Konten organisieren, Kampagnen entfernen oder pausieren und Suchbudgets verwalten.
- Kostenlose Starthilfe: Google bietet Kunden außerdem die Möglichkeit, sich per Telefon beim Starten von Anzeigen von Expertinnen und Experten helfen zu lassen – vorausgesetzt man möchte 10 Euro pro Tag oder mehr ausgeben.
Bevor wir weitergehen, hier noch kurz vorweg: die folgenden Tipps werden sich vorwiegend auf das Google-Suchnetzwerk, also konkret auf Textanzeigen in der Google Suche beziehen. Das Google Display Netzwerk (z.B. Bannerwerbung, Videoanzeigen) werden wir zur besseren Orientierung ein anderes Mal in einem Beitrag besprechen.
Wo soll es hingehen? Definieren Sie Ihre Ziele
Bevor Sie Google Ads Kampagnen erstellen, sollten Sie genau wissen, welche Ziele Sie verfolgen. Besprechen Sie das auch im Team! Alle, die in Ihrem Unternehmen mit Google Ads arbeiten werden, sollten genau wissen, welche Ziele Ihr Unternehmen mit den Kampagnen erreichen möchte, um so die weiteren Aktivitäten abstimmen zu können. Wollen Sie zum Beispiel:
- Zugriffe auf Ihre Website erzielen
- Umsätze und Verkäufe steigern
- Leads (z. B. Newsletteranmeldung) generieren
- Brand Awareness und Reichweite steigern
- Produkt- und Markenkaufbereitschaft erweitern?
Es wäre beispielsweise nicht ideal, wenn Sie eigentlich Conversions (z. B. Ticketverkauf) erzielen möchten, ihr Budget aber mit Brand-Awareness-Kampagnen verpulvern. Außerdem fragt Google Ads beim Erstellen der Kampagne nach dem Ziel beziehungsweise schlägt Ihnen passende Zielvorhaben vor. Sie können diesen Punkt zwar überspringen, doch wenn Sie noch nicht so viel Erfahrung mit dem Tool haben, kann es durchaus hilfreich sein, sich hier von Google helfen zu lassen. Sobald Sie ein Zielvorhaben ausgewählt haben, empfiehlt Ihnen Google außerdem Einstellungen und Funktionen, mit denen Sie die gewünschten Resultate erzielen können.
Außerdem ist es wichtig, dass Sie Ihr Ziel genau im Blick behalten, um so auch in weiterer Folge die Kampagnen bestmöglich optimieren können (z. B. Keywords anpassen). Denn Ihre Anzeigen befinden sich im direkten Wettbewerb mit der Konkurrenz, die ebenfalls für ein ähnliches Angebot um die ersehnten Klicks der Nutzer kämpft. Je genauer und präziser Sie hier schon zu Beginn vorgehen, desto erfolgreicher können Sie Ihre Anzeigen schalten und so Ihr Budget ideal einsetzen.
Strukturieren Sie Ihre Kampagnen
Einer der wichtigsten Punkte, die sie unbedingt beachten sollten, ist die optimale Strukturierung Ihrer Kampagnen. Unterteilen Sie die Kampagnen thematisch und ordnen Sie diesen wiederum nach Sinn, Intention und Thema verschiedene Anzeigengruppen zu. Das hilft Ihnen außerdem Ihre Keywords zu strukturieren und die Anzeigentexte dementsprechend anzupassen. Es hat wenig Sinn, wenn Sie Keywords durcheinander in eine Anzeigengruppe packen und ihnen Anzeigen zuordnen, die genau genommen nicht mal zu den Keywords passen. Schließlich sollten die Keywords auch in den Anzeigen vorkommen. Damit Ihnen das leichter fällt und Ihre Anzeigen eine gute Qualität aufweisen, legen Sie lieber mehrere Anzeigengruppen an und strukturieren Sie hier nach Thema und Intention. Hier können Sie sich auch an den Themenblöcken Ihrer Landingpage orientieren.
Beachten Sie außerdem: Brand-Keywords, also jene, die Ihre Marke (z.B. „XXX“ oder „XXX Schuhe online kaufen“) enthalten, sollten in eigene Kampagnen und Anzeigengruppen geordnet werden. Dasselbe gilt für generische Keywords (z.B. „Schuhe online kaufen“), mit denen Sie allgemeinere Suchanfragen abdecken. Das ist wichtig, da Sie so besser Ihr Budget und die Anzeigentexte angleichen können. Brand-Keywords sind meist günstiger, da wahrscheinlich nicht so viel Konkurrenz auf diese Keywords setzen wird. Bei generischen Keywords ist das schon anders. Hier müssen Sie Ihr Budget aufgrund der höheren Nachfrage gegebenenfalls angleichen. Sprich: mehr Budget einplanen!
Finden Sie die richtigen Keywords
Sobald eine Userin oder ein User ein Wort oder eine Wortgruppe in die Suchmaschine eingibt, haben sie sehr wahrscheinlich auch die Intention zu finden, wonach sie suchen oder jedenfalls Ähnliches ausgespielt zu bekommen. Hier werden die Keywords relevant. Passt eines Ihrer Keywords zum Suchbegehren und spielen Ihnen auch noch andere Umstände, wie zum Beispiel Budget, Qualitätsfaktoren, Geo-Targeting oder die Konkurrenz günstig zu, ist es sehr wahrscheinlich, dass Ihr Keyword das Erscheinen Ihrer Anzeige in der Suche auslöst. Je besser Ihr Keyword zur Suchintention des Users passt, desto eher wird die Userin und der User auf Ihre Anzeige klicken und im besten Falle auch Conversions generieren.
Aus diesem Grund gilt: Fragen Sie sich, was und wonach Menschen suchen, die sich für Ihr Angebot interessieren könnten. Und vor allem auch: Wie wird danach gesucht? Waren es früher häufig kurze Wörter, sogenannte Short-Tail-Keywords, welche vermehrt für die Suche verwendet wurden, sind es heute immer mehr Long-Tail-Keywords, die Suchende in die Suchmaske eingeben. Zumal auch digitale Sprachassistenten immer beliebter werden und dadurch Voice Search an Relevanz erlangt. Aus diesem Grund können auch längere Keywords, die sogar ganze Fragen, wie „Wo gibt es…“ oder „Wo erhalte ich…“, relevant sein. Natürlich nur, wenn das Keyword zu den angeworbenen Produkten, Dienstleistungen, etc. passt.
- Was Sie auf alle Fälle vermeiden sollten: Verwenden Sie keinesfalls irgendwelche Keywords, nur weil sie im Entferntesten passen könnten. Sie laufen so Gefahr, dass Ihre Anzeigen erst gar nicht ausgespielt werden, weil die Keywords nicht zu den Anzeigen und Ihrem Angebot passen. Außerdem riskieren Sie Streuverluste. Je präziser und genauer Sie hier sind, umso relevanter schätzt Google Sie in der Auktion um die obersten Plätze in den Suchergebnissen ein.
Tipp: Keyword Planner: Bevor Sie also Keywords den Anzeigengruppen beziehungsweise den Anzeigen zuteilen, recherchieren Sie umfangreich. Überprüfen Sie, welche Keywords für Sie wirklich relevant sind. Google Ads stellt hierfür den „Keyword Planner“ zur Verfügung. Hierbei handelt es sich um ein Recherchetool, das direkt in Google Ads integriert ist und Ihnen helfen soll, passende oder ähnliche Suchbegriffe zu finden. Hier können Sie sich Keywordideen holen, die Performance der Keywordvorschläge ansehen oder Prognosen zu den Keywords abrufen. Wenn Sie also noch keine Erfahrung haben, welche Keywords zu Ihrem Angebot passen könnten oder wie die Performance dazu aussehen könnte, sind Sie hiermit gut beholfen. Lassen Sie sich nicht entmutigen. Manchmal kann es dazukommen, dass bei sehr speziellen Suchbegriffen, nicht ausreichend Daten zur Verfügung stehen und sie kaum Vorschläge oder Prognosen erhalten.
Als weitere kostenlose Möglichkeit könnten Sie Google Trends heranziehen und überprüfen, wie sich das Suchinteresse der User zu gewissen Begriffen verhält. Hier lassen sich Suchbegriffe miteinander vergleichen und das Interesse der Suchenden im zeitlichen Verlauf ansehen.
Achtung! Keywords ausschließen: Dieser Punkt wird gerne vergessen, dabei ist er durchaus relevant. Vor allem, wenn Sie breitere Keyword Optionen (sog. Match Types), wie „Broad Match“ oder „Modified Broad Match“ wählen, kann es vorkommen, dass ihre Anzeigen auch durch Keywords getriggert werden, die Ihren hinterlegten Keywords zwar ähnlich sind, Sie aber bei diesen Suchbegriffen nicht erscheinen möchten. Verknüpfen Sie also mit Ihren Kampagnen oder Konten Keyword Listen, welche die von Ihnen gewünschten auszuschließenden Keywords enthalten. So können Sie einerseits Kosten sparen, weil Ihre Anzeigen nicht zu irrelevanten Suchanfragen ausgespielt werden, andererseits auch auf Ihre Brand Awareness achten, indem Ihre Anzeigen, drastisch formuliert, nicht über News zu einem Skandal ranken.
Optimieren Sie laufend
Wer Kampagnen in Google Ads schaltet und damit auch seine Ziele erreichen möchte, sollte sie stets optimieren. Und zwar laufend! Vor allem zu Beginn sollten Sie sich genau ansehen, wie Ihre Kampagnen im Gesamten und auch granularer betrachtet, wie die Anzeigengruppen, Anzeigentexte, Keywords, Erweiterungen, etc. performen. In gewisser Weise ist das Schalten von Anzeigen in Google Ads auch „Learning by doing“ und Erfahrungswerte werden hier zur kostbaren Ware. Besonders zu Beginn läuft man Gefahr, nicht so richtig zu wissen, auf welche Kennzahlen man achten sollte oder was man sich nun ansehen sollte. Hilfreich ist hierbei auch die Verwendung von Tracking, das über die standardisiert gemessenen Daten von Google Ads hinausgeht. Implementieren Sie also auch Conversion Tracking, wenn Ihnen Conversions wichtig sind, und verknüpfen Sie Google Analytics. Natürlich nur unter der Berücksichtigung des Datenschutzes!
Worauf sollten Sie für Ihre Optimierung zum Beispiel achten?
- Keyword-Performance: Sie wollen wissen, ob Sie die richtigen Keywords eingebucht haben und das Suchinteresse der User wirklich abdecken? Sehen sie nach und machen Sie regelmäßig Suchanfrage-Berichte! Unter dem Reiter „Keywords“ bei „Suchbegriffe“ sehen Sie, welche Keywords die Userinnen und User eingegeben haben, um auf Ihre Anzeigen zu kommen. Hier sehen Sie auch Keywords, die Sie noch nicht eingebucht haben. Das kann Ihnen helfen, neue Keywords zu finden. Gegebenenfalls auch Ihre Kampagnen, um Themengebiete zu erweitern. Wenn Sie beispielsweise Schuhe verkaufen und im Sommer hauptsächlich auf Anzeigen zum Thema Sandalen setzen, die Userinnen und User jedoch vermehrt nach Sportschuhen in Verbindung mit Ihrer Marke suchen, dann wären Sie gut beraten, Anzeigen zu Ihren Sportschuhen zu schalten. Außerdem können Sie anhand der Suchbegriffe sehen, welche Keywords Sie weiter ausschließen sollten. Entfernen Sie außerdem Keywords, die nach einem längeren Zeitraum keine Performance zeigen. So können Sie in Ihren Anzeigengruppen Ordnung halten, behalten den Überblick und können Ihre Zeit anderen Themen widmen.
- Anzeigentexte: Wenn Sie es geschafft haben, dass Ihre Anzeige in der Auktion „gewonnen“ hat und auch in einer guten Anzeigenposition erscheint, kommt die nächste Hürde, die überwunden werden muss. Die Userinnen und User sollen auf Ihre Anzeige klicken und sich für Ihr Angebot interessieren. Hier spielen die Anzeigentexte eine wichtige Rolle. Sie sollen die Suchenden auf Ihre Homepage bewegen. Beachten Sie beim Texten das Suchinteresse, gehen Sie auf ihre Bedürfnisse ein und achten Sie auf die Sprache Ihrer Zielgruppe. Verwenden Sie außerdem Call-to-Actions und bauen Sie die Keywords in die Texte ein. Achten Sie beim Texten auch auf die Zeichenbeschränkung! Wenn Sie zu viele Zeichen verwenden, werden Ihre Anzeigen erst gar nicht ausgespielt. Pro-Tipp: Nützen Sie dennoch all die Zeichen aus, die Ihnen zur Verfügung stehen. So können Sie wichtige Infos verpacken und Ihre Anzeige erscheint „größer“ in den Suchergebnissen. Sie fällt den Suchenden dadurch schneller ins Auge und wird als relevanter eingeschätzt. Hilfreich könnte Ihnen dabei auch der Google Ads Editor sein. Hierbei handelt es sich um ein Tool zur Bearbeitung und Erstellung von Anzeigen, das sogar offline genutzt werden kann. Es kann Ihnen zu Beginn sehr hilfreich sein, da die Änderungen erst hochgeladen werden müssen, bevor Sie online gehen. So können diese auch am nächsten Tag nochmal überprüft oder im Team besprochen werden.
- Qualitätsfaktor: Google schätzt die Qualität Ihrer Anzeigen nach gewissen Gesichtspunkten. Hier werden vor allem Ihre Anzeigen, Landingpages und Keywords ins Visier genommen. Ist die Qualität gut, dann haben Sie schon mal die halbe Miete. Denn ein hoher Qualitätsfaktor kann Ihnen Kosten sparen und Ihnen den Weg zur obersten Anzeigenposition in den Suchergebnissen ebnen. Überprüfen Sie also konstant: Passen meine Anzeigen zum Angebot auf der Landingpage? Kommen die Keywords in den Anzeigentexten vor und auch auf der Landingpage? Ist meine Landingpage gut erreichbar, lädt Sie schnell und sind die Inhalte dort auch relevant? All diese Faktoren können bedeutend sein und sollten stets beachtet werden.
Zu guter Letzt: Testen Sie!
Google Ads ermöglicht es Ihnen mithilfe von Kampagnenentwürfen, Tests zu generieren. Anhand der Entwürfe können Sie Änderungen für einen bestimmten Zeitraum zuerst testen, bevor Sie diese auf die Kampagne anwenden. So können Sie beispielsweise neue Gebotsstrategien probieren und sich ansehen, wie sich ihre Performance verhält. Mithilfe der Anzeigenrotation können Sie außerdem testen, welche Anzeigen am besten performen und für Sie dadurch relevant sind. Google Ads wählt automatisch jene Anzeigen aus, die am besten performen und schaltet diese auch häufiger.
Wenn Sie also erfolgreich mit Ihren Google Ads Kampagnen sein möchten, sollten Sie stets die Performance Ihrer Anzeigen im Blick behalten und Ihre Kampagnen laufend optimieren. Auch wenn das zu Beginn aufwendig erscheinen mag, so wird es mit den Erfahrungswerten immer leichter. Bleiben Sie konsequent am Ball und Sie werden sehen: die ersten Erfolge werden sie weiter motivieren!
Sie haben sich entschlossen, einen Podcast zu produzieren und fragen sich, welches Mikrofon das richtige für ihre Zwecke ist? Wir helfen Ihnen mit diesem kurzen Leitfaden, aus den unzähligen Modellen ihr Podcast Mikro und die richtige Art, aufzuzeichnen, zu finden.
Mit der steigenden Zahl an Podcasts ist auch das Angebot an Podcast Mikrofonen unterschiedlichster Hersteller gewachsen. Einerseits macht es das nicht unbedingt einfacher, sich für ein Gerät zu entscheiden. Andererseits gibt es inzwischen für jedes Budget und jede Anforderung ein gutes Mikrofon. Dieser Blogpost soll Sie dabei unterstützen, das für Sie geeignete Equipment zu finden.
Was möchten Sie aufnehmen?
Zum einen hängt die Entscheidung davon ab, was in Ihrem Podcast zu hören sein wird. Denn Podcasts, in denen Menschen in einer kontrollierten Umgebung reden, dominieren zwar, sie sind aber längst nicht die einzige Form. Für Stimmaufnahmen in einer studioähnlichen Situation, also an einem ruhigen Ort ohne Bewegung, gibt es klassische Studiomikrofone. Für Reportage-Elemente und atmosphärische Aufnahmen sind sie jedoch weniger geeignet. Hierfür bieten sich Richtmikrofone an, die zusätzlich für Interviews im Stil eines Reportermikrofons eingesetzt werden können.
Weiters sollten Sie sich im Klaren darüber sein, wie viele Tonspuren sie gleichzeitig aufnehmen wollen. Wird ihr Podcast von einer Person eingesprochen oder unterhalten sich zwei oder mehr Menschen miteinander? Davon hängt nicht nur ab, wie viele Mikrofone (und damit verbunden Anschlussmöglichkeiten) sie benötigen, sondern auch, wie sie diese organisieren und aufzeichnen. Denn um möglichst guten Klang und eine leichte Bearbeitung zu ermöglichen, wird üblicherweise für jede Sprecherin und jeden Sprecher eine eigene Aufnahme bzw. Tonspur erstellt, die erst nach der Bearbeitung gemeinsam als eine Datei ausgespielt werden.
Wie möchten Sie aufnehmen?
Auch hier haben Sie viele Möglichkeiten: Neben dem Laptop, einer Audioschnittstelle (mit besonderen Anschlüssen und Einstellungsmöglichkeiten) für den PC oder dem Smartphone kann ein Aufnahmegerät die richtige Wahl sein. Wenn Sie hauptsächlich in ruhigen Interviewsettings arbeiten, reicht eine stationäre Lösung mit einem PC oder Laptop völlig aus. Für die Aufnahme in ein Programm am Laptop sind Mikrofone mit USB-Anschluss die einfachste und daher eine sehr beliebte Variante, da außer dem Mikrofon mit einem guten (stabil und flexibel einstellbar) Mikrofonständer und Pop-Schutz nichts weiter benötigt wird.
Trotzdem werden Ihnen auch Mikrofone mit einem sogenannten XLR-Anschluss unterkommen. Dabei handelt es sich um einen Industriestandard für elektronische Steckverbindungen, die bei Veranstaltungstechnik und in professionellen Studios zum Einsatz kommt. Vor allem wenn Sie in Ihrem Podcast unterwegs sind, ist die Möglichkeit per XLR etwa auf ein kompaktes Aufnahmegerät aufzeichnen zu können, spannend. So können Sie sich beispielsweise bei Veranstaltungen am lokalen Mischpult anhängen, um einen Vortrag über das Mikrofon der Rednerin oder des Redners mitschneiden zu können. Dies kann Ihnen auch ein Adapter von XLR auf Klinkenanschluss ermöglichen, dennoch sind die unterschiedlichen Anschlüsse beziehungsweise ihre Einheitlichkeit bei der Beschaffung Ihres Equipments zu bedenken. Ein mobiler Audiorecorder bietet zusätzlich den Vorteil, dass er etwas kleiner und unauffälliger ist und Sie Ihren Laptop weiter uneingeschränkt nutzen können, während Sie aufzeichnen.
Was ist Phantomspeisung und wozu?
Mikrofone können den benötigten Strom einerseits aus einer eigenen Stromquelle beziehen. Werden sie andererseits jedoch vom Aufnahmegerät (Recorder, Laptop etc.) mit Strom versorgt, so spricht man von Phantomspeisung. USB-Geräte haben den Vorteil, dass sie quasi immer den Strom vom jeweiligen Gerät erhalten, an das sie angeschlossen werden. Bei XLR-Anschlüssen muss man hingegen darauf achten, dass der Recorder oder die Audioschnittstelle die benötigte Spannung bereitstellen können, sofern das Mikrofon keine eigene Stromversorgung besitzt. Geräte mit Phantomspeisung gelten als etwas zuverlässiger als Geräte, bei denen man die Funktion von Akkus und Batterien extra überprüfen muss.
Welches Setup für welchen Podcast?
Sowohl bei Studio- als auch bei Richtmikrofonen sollten Sie sich nicht von besonders hochpreisigen Modellen verunsichern lassen. Ein Profigerät kommt schon mal auf einen vierstelligen Eurobetrag. So viel müssen Sie jedoch definitiv nicht in die Hand nehmen. Es gibt ein gutes Preisleistungsverhältnis und eine solide Audioqualität ab etwa 80 Euro pro Mikrofon. Wichtig ist, dass Ihr Setup den Bedürfnissen Ihres Podcasts entspricht. Zusammenfassend möchten wir Ihnen zu drei groben Podcastkategorien den Anforderungen entsprechende Vorschläge machen:
- Der einfache Interviewpodcast
Ihr Podcast wird in einem ruhigen Setting aufgenommen. Im Zentrum steht, was gesagt wird, nicht was in der Umgebung passiert. Sie möchten die Ausstattung so einfach wie möglich halten, aber nicht auf guten Klang verzichten.
Laptop + Rode Podcaster USB Mikro (mit Kopfhöreranschluss ab ca. 200 Euro pro Stück)
- Der Themenpodcast
Über Interviews in Studiosetting hinaus sammeln Sie Audioaufzeichnungen auf Veranstaltungen. Mit einem Audiorecorder sind Sie unterwegs flexibel und haben neben 2 XLR-Anschlüssen die Möglichkeit, direkt atmosphärisches Audiomaterial aufzunehmen. Im Studio müssen Sie nicht auf die gute Qualität eines Kondensatormikrofons verzichten.
Zoom H4 (ab ca. 220 Euro) + T Bone SC 400 (ab ca. 100 Euro mit Popschutz und Mikroständer)
- Der Reportagepodcast
Sie fangen Szenen vor Ort ein und möchten die Hörerinnen und Hörer mit an den Ort des Geschehens nehmen. Das zusätzliche Richtmikrofon ermöglicht Ihnen unterwegs flexibel klanglich saubere Interviews einzufangen. Mit einem passenden Mikrofonständer können Sie Ihren Podcast im Studio einsprechen, oder mit zusätzlichen Studiomikrofonen Gesprächsrunden aufzeichnen.
Zoom H4 + Rode NTG1 Richtmikrofon (ab ca. 200 Euro)
- Die größere Gesprächsrunde
Sie veranstalten Tischgespräche und Diskussionen und zeichnen sie mit einem kompakten Aufnahmegerät übersichtlich auf.
Zoom H6 (4 XLR-Eingänge mit Drehregler für Pegel und Phantomspeisung) + Zoom EXH-6 Combo Capsule (Erweiterung um 2 XLR Eingänge ohne Phantomspeisung) + XLR-Kondensatormikro
